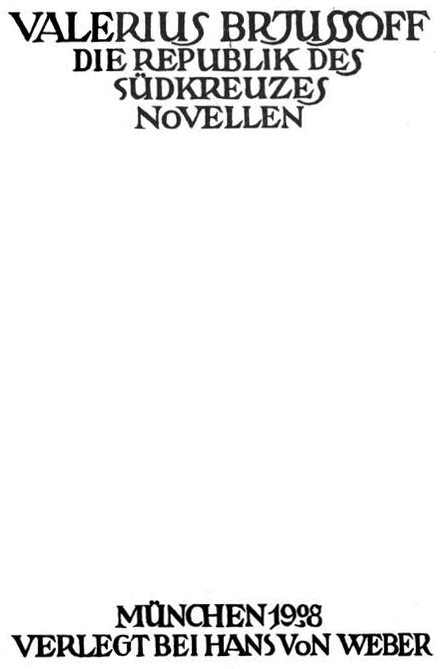
Project Gutenberg's Die Republik des Südkreuzes, by Waleri Brjussow
This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with
almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or
re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included
with this eBook or online at www.gutenberg.org
Title: Die Republik des Südkreuzes
Novellen
Author: Waleri Brjussow
Translator: Hans von Guenther
Release Date: January 7, 2012 [EBook #38518]
Language: German
Character set encoding: ISO-8859-1
*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK DIE REPUBLIK DES SÜDKREUZES ***
Produced by Jens Sadowski
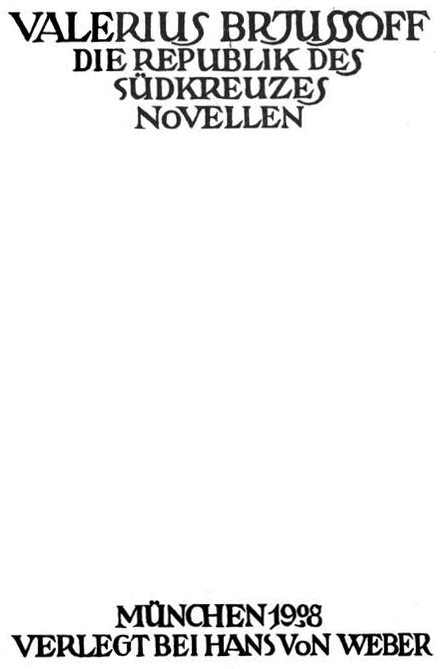
Anmerkungen zur Transkription finden sich am Ende des Buches.
München 1908
Verlegt bei Hans von Weber
Die autorisierte Übertragung dieses Buches aus dem Russischen ist von Hans von Guenther besorgt. Den künstlerischen Schmuck zeichnete Otto zu Gutenegg. Gedruckt wurde es bei Oscar Brandstetter zu Leipzig. 50 Exemplare wurden auf Van Geldern abgezogen, in goldgepreßtes Leder gebunden und handschriftlich numeriert.
Jetzt aber, wo ich erwacht bin . . .
Artikel der Spezialnummer des „Nordeuropäischen Abendblattes“
 In letzter Zeit erschien eine ganze Reihe von Beschreibungen
jener entsetzlichen Katastrophe,
welche die Republik des Südkreuzes heimsuchte.
Sie sind einander überraschend unähnlich und
geben nicht wenig offenbar phantastische und unwahrscheinliche
Begebenheiten wieder. Die Zusammensteller
dieser Beschreibungen verhielten sich augenscheinlich
zu leichtgläubig gegenüber den Berichten jener Bewohner
der Sternenstadt, die sich gerettet hatten, und die, was
ja bekannt ist, alle von einer psychischen Störung betroffen
wurden. Darum also halten wir es für nützlich und
zeitgemäß, die Summe aller glaubwürdigen Nachrichten,
die uns bislang von der Tragödie auf dem Südpole bekannt
wurden, zu ziehen.
In letzter Zeit erschien eine ganze Reihe von Beschreibungen
jener entsetzlichen Katastrophe,
welche die Republik des Südkreuzes heimsuchte.
Sie sind einander überraschend unähnlich und
geben nicht wenig offenbar phantastische und unwahrscheinliche
Begebenheiten wieder. Die Zusammensteller
dieser Beschreibungen verhielten sich augenscheinlich
zu leichtgläubig gegenüber den Berichten jener Bewohner
der Sternenstadt, die sich gerettet hatten, und die, was
ja bekannt ist, alle von einer psychischen Störung betroffen
wurden. Darum also halten wir es für nützlich und
zeitgemäß, die Summe aller glaubwürdigen Nachrichten,
die uns bislang von der Tragödie auf dem Südpole bekannt
wurden, zu ziehen.
Die Republik des Südkreuzes entwickelte sich vor etwa vierzig Jahren aus 300 in den südpolaren Gebieten gelegenen Stahlfabriken. In einem Zirkular, das allen Regierungen des Erdballes zugesandt wurde, erhob der neue Staat Ansprüche auf alle Länder, ob sie nun kontinentalen oder insularen Charakters waren, die in dem Bezirke des südpolaren Kreises lagen, wie auch auf jene Teile dieser Länder, die über dieses Gebiet hinausragten. Er erklärte sich bereit, diese Länder von den Regierungen käuflich zu erwerben, unter deren Protektorate sie standen. Die Prätensionen der neuen Republik begegneten keinem Widerstand von seiten der fünfzehn Großmächte der Erde. Einige strittige Punkte betreffs weniger Inseln, die außerhalb des Polarkreises lagen, dennoch aber eng an das südpolare Gebiet grenzten, erforderten besondere Traktate. Nach Erfüllung verschiedener Formalitäten wurde die Republik des Südkreuzes in die Familie der Weltherrschaften aufgenommen und ihre Vertreter bei den in Frage kommenden Regierungen akkreditiert.
Die Hauptstadt der Republik, die den Namen der Sternenstadt erhielt, war am Pole gelegen. An jenem gedachten Punkte, den die Erdachse berührt und wo alle Meridiane zusammentreffen, stand das städtische Rathaus, und die Spitze seines Fahnenmastes war zum Zenith des Himmels emporgerichtet. Die Straßen der Stadt entfernten sich vom Rathaus in der Richtung der Meridiane, und die Meridionalen wurden von anderen durchschnitten, die in der Richtung der Parallelkreise strebten. Die Höhe und das Äußere aller Baulichkeiten waren gleichartig. Die Wände hatten keine Fenster, denn das Innere der Gebäude war durch Elektrizität beleuchtet. Elektrizität beleuchtete auch die Straßen. In Anbetracht des rauhen Klimas war über der Stadt ein das Licht abschließendes Dach errichtet worden, in das mächtige Ventilatoren eingelassen waren, zum beständigen Erneuern der Luft. Jene Länder des Erdballes kennen im Laufe des Jahres nur einen Tag von sechs Monaten und eine lange Nacht von gleichfalls sechs Monaten, doch die Straßen der Sternenstadt wurden beständig vom gleichen und klaren Lichte beschienen. Ganz ebenso, wie zu allen Jahreszeiten die Temperatur auf den Straßen künstlich auf der gleichen Höhe gehalten wurde.
Nach der letzten Zählung erreichte die Zahl der Sternenstadtbewohner die Höhe von 2500000 Menschen. Die ganze übrige Bevölkerung der Republik, die auf 50000000 geschätzt wurde, verteilte sich auf die Hafenstädte und Fabriken. Diese Punkte bildeten gleichfalls Ansammlungen von Millionen Leuten und erinnerten in ihrem Äußeren an die Sternenstadt. Dank einer geistvollen Anwendung elektrischer Kraft, waren die Einfahrten aller offenen Häfen das ganze Jahr über eisfrei. Elektrisch betriebene Hängebahnen verbanden die bewohnten Orte der Republik miteinander und auf ihnen wurden täglich Zehntausende von Menschen und Millionen Kilogramm Waren aus einer Stadt in die andere befördert. Was das Innere des Landes anbetrifft, so blieb es unangesiedelt. Vor den Blicken der Reisenden, die durchs Waggonfenster schauten, zogen nur einförmige Wüsten vorbei, die im Winter völlig weiß und nur in den drei Sommermonaten von spärlichem Grase bewachsen waren. Wilde Tiere waren schon längst ausgerottet, und für das Leben fehlte dort jegliche Existenzmöglichkeit. Doch um so erstaunlicher war das angeregte Leben in den Hafenstädten und Fabrikzentren. Um einen Begriff von diesem Leben zu geben, sei nur erwähnt, daß in den letzten Jahren etwa sieben Zehntel allen Metalles, das auf der Erde zutage gefördert wurde, in den staatlichen Fabriken der Republik zur Umarbeitung gelangten.
Die Konstitution der Republik schien äußerlich die völlige Verkörperung von Volksherrschaft darzustellen. Als die einzig voll berechtigten Bürger galten die Arbeiter der metallurgischen Fabriken, die etwa 60 Prozent der Bevölkerung bildeten. Diese Fabriken waren Staatseigentum. Das Leben der Arbeiter auf den Fabriken war nicht nur mit allen möglichen Bequemlichkeiten ausgestattet, sondern sogar luxuriös. Zu ihrer Verfügung standen außer den wundervollen Räumlichkeiten und einem erlesenen Tische noch die verschiedensten Bildungsmittel und Zerstreuungen: Bibliotheken, Museen, Theater, Konzerte, Säle für alle Arten Sport usw. Die tägliche Zahl der Arbeitsstunden war eine äußerst geringe. Um Erziehung und Bildung der Kinder, um medizinische und juristische Hilfe, um Gottesdienst aller Religionen bekümmerte sich die Regierung. Die in der Befriedigung aller ihrer Nöte, ihres Bedarfes, ja selbst ihrer Wünsche ganz sorglos gestellten Arbeiter der staatlichen Fabriken erhielten allerdings für ihre Arbeit keine Geldentschädigung; doch die Familien der Bürger, die mehr als 20 Jahre auf einer Fabrik gedient hatten, wie auch jene der im Dienste gestorbenen oder arbeitsunfähig gewordenen, erhielten eine reiche lebenslängliche Pension unter der Bedingung, die Republik nicht zu verlassen. Aus der Zahl der Arbeiter wurden auf dem Wege allgemeiner Stimmabgabe Vertreter gewählt für die gesetzgebende Kammer der Republik, die alle Fragen des politischen Lebens im Lande entschied, ohne allerdings das Recht zu haben, es in seinen Grundgesetzen zu verändern.
Dies demokratische Äußere verhüllte eine rein selbstherrliche Tyrannei der Mitglieder und Begründer des früheren Trustes. Den anderen die Plätze der Deputierten in der Kammer überlassend, wählten sie immer nur ihre Kandidaten zu Direktoren der Fabriken. In den Händen des Rates dieser Direktoren konzentrierte sich das ganze ökonomische Leben des Landes. Sie empfingen alle Bestellungen und verteilten sie an die Fabriken; sie kauften Material und Maschinen für die Arbeit; sie führten die ganze Haushaltung in den Fabriken. Durch ihre Hände flossen ungeheure Summen Geldes, die nach Milliarden zählten. Die gesetzgebende Kammer hatte immer nur die ihr vorgelegten Quittungen der Ausgaben und Einnahmen in der Fabrikverwaltung zu bestätigen, obgleich oftmals die Balance dieser Quittungen das ganze Budget der Republik weit überwog. Der Einfluß des Direktorenrates auf die internationalen Verhältnisse war ungeheuer. Seine Entschlüsse konnten ganze Länder arm machen. Die Preise, die er aufstellte, bestimmten den Verdienst von Millionen arbeitender Menschen auf der ganzen Erde. Gleichzeitig war, wenn auch nicht so direkt, der Einfluß des Rates auf die inneren Geschicke der Republik immer entscheidend. Die gesetzgebende Kammer vollstreckte im Grunde nur gehorsam den Willen des Rates.
Diese Gewalt konnte der Rat nur durch ein unerbittliches Reglement des ganzen Lebens im Lande in seinen Händen erhalten. Bei anscheinender Freiheit war das bürgerliche Leben bis herab zu den kleinsten Kleinigkeiten normiert. Die Gebäude aller Städte in der Republik wurden nach ein und demselben vom Gesetz bestimmten Muster gebaut. Die Ausstattung aller Räumlichkeiten, die den Arbeitern zur Verfügung standen, war bei all ihrer Pracht doch aufs strengste einförmig. Alle erhielten die gleiche Speise zur gleichen Stunde. Die Kleidung, welche die Staatsspeicher hergaben, war unveränderlich und immer zehn Jahre von gleicher Art. Nach einer bestimmten Stunde, die ein Signal vom Rathaus her ankündigte, war es nicht gestattet, aus dem Hause zu gehen. Die ganze Presse war einer strengen Zensur untergeordnet. Kein Aufsatz, der gegen die Diktatur des Rates gerichtet war, wurde durchgelassen. Übrigens war das ganze Land so sehr von der Wohltätigkeit eben dieser Diktatur überzeugt, daß die Setzer sich weigerten, Zeilen zu setzen, welche den Rat kritisierten. Alle Fabriken waren voll Agenten des Rates. Bei der geringsten Unzufriedenheit mit dem Rat beeilten sich diese Agenten auf eilig versammelten Meetings, in leidenschaftlichen Reden alle Zweifelnden zu überzeugen. Der wirkungsvollste Beweis war natürlich jener, daß das Leben der Arbeiter in der Republik für die ganze Welt ein Gegenstand des Neides sei. Man sagt auch, daß der Rat, im Falle unentwegter Agitation einzelner Personen, einen politischen Mord nicht verschmähte. Jedenfalls aber wurde, so lange die Republik besteht, bei der allgemeinen Stimmabgabe noch kein Direktor von den Bürgern in den Rat gewählt, der den Gründern feindlich gewesen wäre.
Die Einwohner der Sternenstadt bestanden hauptsächlich aus Arbeitern, die ihre Zeit abgedient hatten. Das waren, sozusagen, Rentiers des Staates. Die Regierung gab ihnen Mittel und Möglichkeit, komfortabel zu leben. Darum ist es nur natürlich, daß die Sternenstadt in den Ruf einer der fröhlichsten Städte auf der Welt kam. Für verschiedene Entrepreneure war dies ein gefundenes Fressen. Die Berühmtheiten der ganzen Welt trugen ihre Talente hierher. Hier waren die besten Opern, Konzerte, Kunstausstellungen; hier erschienen die bestunterrichteten Zeitungen. Die Magazine der Sternenstadt überraschten durch reiche Auslagen, die Restaurants durch Pracht und Erlesenheit der Gedecke; die Freudenhäuser betörten durch alle Formen des Lasters, welche die alte und neue Welt erdacht hatten. Trotzdem war das von der Regierung ausgehende Reglement des Lebens auch in der Sternenstadt zu bemerken. Es ist wahr, die Ausstattung der Wohnungen, die Moden der Gewänder waren nicht eingeschränkt, doch auch hier blieb das Verbot des Ausgehens nach einer bestimmten Stunde in Kraft, gleichwie die Strenge der Preßzensur, und der Rat hielt sich auch hier eine ganze Armee von Spionen. Die Ordnung wurde offiziell von der Volkswacht aufrecht erhalten, doch Seite an Seite mit ihr existierte die geheime Polizei des allwissenden Rates.
In den allgemeinen Zügen war dies das Leben in der Republik des Südkreuzes und ihrer Hauptstadt. Aufgabe eines künftigen Historikers dürfte es sein, zu bestimmen, in wieweit dieses Leben auf die Entstehung und Verbreitung jener unheilvollen Epidemie einwirkte, die zum Untergange der Sternenstadt führte und vielleicht auch zu dem des ganzen jungen Staates.
Die ersten Fälle einer Erkrankung am „Widerspruche“ wurden schon vor etwa 20 Jahren in der Republik bemerkt. Damals trug diese Krankheit noch einen zufälligen und sporadischen Charakter. Die dort ansässigen Psychiater und Neuropathologen interessierten sich für sie, gaben ihre genaue Beschreibung und es wurden ihr auch auf dem damals in Lhassa stattfindenden internationalen Medizinerkongreß mehrere Berichte gewidmet. Allein man vergaß sie später, obwohl es in den psychiatrischen Kliniken der Sternenstadt niemals an von dieser Krankheit Befallenen mangelte. Seinen Namen erhielt dies Leiden daher, daß die an ihm erkrankten beständig sich selbst und ihren Wünschen widersprachen, das eine wollten, aber ein ganz anderes sagten oder taten. (Der wissenschaftliche Name dieser Krankheit ist mania contradicens.) Sie setzt gewöhnlich mit schwach angedeuteten Symptomen ein, vorwiegend in einer Art eigentümlicher Aphasie. Der Erkrankte sagt anstatt „Ja“ — „Nein“; an Stellen von freundschaftlichen Worten, überschüttet er den anderen mit Schimpfreden usw. Größtenteils beginnt der Kranke gleichzeitig zu sich selbst und seinen Handlungen in Widerspruch zu treten; will er links gehen, so wendet er sich nach rechts; gedenkt er seinen Hut abzunehmen, um besser sehen zu können, so drückt er sich ihn um so tiefer in die Stirne usw. Bei einer Weiterentwicklung der Krankheit erfüllen diese Widersprüche das ganze körperliche und seelische Leben des Kranken, dabei natürlich mit großer Mannigfaltigkeit und der individuellen Eigenheit eines jeden entsprechend auftretend. Im allgemeinen sind die Reden des Kranken unverständlich, seine Handlungen töricht. Auch die Regelmäßigkeit der physiologischen Verrichtungen des Organismus wird gestört. Das Unvernünftige seines Handelns erkennend, gerät der Kranke in äußerste Erregung, die oft an Ekstase grenzt. Sehr viele beenden ihr Leben durch Selbstmord, was zuweilen in einem Wahnsinnsanfall geschieht, zuweilen aber auch in Minuten seelischer Klarheit. Einige sterben durch einen Bluterguß ins Gehirn. Fast immer führt die Krankheit zu einem letalen Ende; Fälle der Wiederherstellung sind äußerst selten.
In der Sternenstadt nahm die mania contradicens erst in den mittleren Monaten dieses Jahres ihren epidemischen Charakter an. Bis zu dieser Zeit war die Zahl der an Widerspruch erkrankten niemals größer als 2 Prozent der überhaupt Erkrankten. Doch dieses Verhältnis stieg im Mai (dies ist ein Herbstmonat in der Republik) plötzlich auf 25 Prozent und wurde in den folgenden Monaten immer größer, während gleichzeitig auch die absolute Zahl der Erkrankungen proportional wuchs. In der Mitte des Juni waren schon 2 Prozent der ganzen Bevölkerung, d. h. etwa 50000 Menschen offiziell als am Widerspruch erkrankt erklärt. Nach dieser Zeit fehlen alle statistischen Daten. Die Krankenhäuser waren überfüllt. Das Kontingent der Ärzte war bald zu klein. Dazu kam noch, daß auch die Ärzte sowie die Krankenwärter der Krankheit erlagen und sehr bald schon war es vielen Kranken unmöglich, ärztliche Hilfe zu erlangen, und deshalb wurde eine genaue Registrierung der Krankheitsfälle illusorisch. Übrigens treffen die Berichte aller Augenzeugen darin zusammen, daß man bereits im Juli keine Familie mehr sehen konnte, in der nicht ein Erkrankter gewesen wäre. Zu diesem kam noch, daß die Zahl der Gesunden sich beständig verringerte, da eine Massenemigrierung aus der Stadt, wie aus einem verseuchten Orte, begann, und die Zahl der Kranken zunahm. Es läßt sich denken, daß jene nicht weit von der Wahrheit entfernt sind, welche behaupten, daß schon im August alle, die in der Sternenstadt zurückgeblieben waren, von einer psychischen Störung ergriffen waren.
Das erste Auftreten der Epidemie kann man in den dortigen Zeitungen verfolgen, die das alles in eine ständig anwachsende Rubrik eintrugen: Mania contradicens. Da es so schwierig ist, die Krankheit in ihren ersten Stadien zu erkennen, so ist die Chronik der Tage im Beginn der Epidemie voll von komischen Episoden. Ein erkrankter Kondukteur der Metropolitaine nahm kein Geld von den Passagieren, sondern zahlte es ihnen. Ein Straßenwächter, dessen Pflicht es war, die Bewegung auf der Straße zu regulieren, hemmte und verwirrte sie im Verlaufe eines ganzen Tages. Ein Museumsbesucher nahm in den Sälen, die er durchschritt, alle Bilder herunter und hängte sie umgekehrt wieder auf. Eine Zeitung, deren Korrektur von einem erkrankten Redakteur gelesen wurde, war voll lächerlicher Versehen. Im Konzerte störte plötzlich ein erkrankter Geiger durch fürchterliche Dissonanzen, die vom Orchester ausgeführte Pièce usw. Eine lange Reihe solcher Zufälle gab den dortigen Feuilletonisten Stoff zu witzigen Ausfällen. Doch einige Ereignisse anderer Art brachten bald die Spötter zum Schweigen. Das erste bestand darin, daß ein Arzt, der am „Widerspruch“ erkrankt war, einem Mädchen ein unbedingt tödliches Mittel verschrieb, und daß seine Patientin starb. Ganze drei Tage waren die Zeitungen mit diesem Vorfall beschäftigt. Dann waren es zwei Ammen, die im Stadtkindergarten in einem Anfall des Widerspruchs einundvierzig Kindern die Gurgel durchschnitten. Die Nachricht von diesem Fall erschütterte die ganze Stadt. Doch am selben Tage rollten zwei Erkrankte aus dem Hause, in dem die Stadtmilizen einquartiert waren, eine Mitrailleuse und überschütteten die friedlich wandelnde Menge mit Kartätschen. An 500 Menschen wurden getötet oder verwundet.
Nach diesem Vorfall begannen alle Zeitungen, sowie die ganze Gesellschaft stürmisch nach sofortigen Maßregeln gegen die Epidemie zu verlangen. In einer Extrasitzung des Stadtrates und der gesetzgebenden Kammer wurde beschlossen, Ärzte aus den anderen Städten und dem Auslande aufzufordern, sofort die alten Krankenhäuser zu vergrößern, neue zu eröffnen, sowie Häuser zur Isolierung der am „Widerspruch“ Erkrankten zu gründen, eine Broschüre über die neue Krankheit, in der auf alle Anzeichen und Heilungsmethoden hingewiesen werden sollte, in 500000 Exemplaren drucken und verteilen zu lassen, und endlich in allen Straßen spezielle Jouren von Ärzten und ihren Gehilfen zu organisieren, sowie auch regelmäßige Besuche in den Privatquartieren zum Erweisen der ersten Hilfe usw. Es wurde auch beschlossen, täglich ausschließlich für Kranke bestimmte Züge auf allen Strecken verkehren zu lassen, da die Ärzte als bestes Mittel gegen die Krankheit eine Ortsveränderung empfahlen. Ähnliche Mittel wurden gleichzeitig auch von verschiedenen Privatassoziationen, Vereinigungen und Klubs ergriffen. Es wurde sogar eine besondere „Gesellschaft zum Kampf mit der Epidemie“ begründet, deren Mitglieder schon bald eine wirklich aufopfernde Tätigkeit entwickelten. Doch ungeachtet dessen, daß all diese und ähnliche Mittel mit unermüdlicher Energie durchgeführt wurden, wurde die Epidemie nicht schwächer, sondern mit jedem Tage stärker, betraf in gleicher Weise Kinder und Greise, Männer und Frauen, arbeitende Menschen und solche, die sich erholten, Asketen und Wüstlinge. Und bald wurde die ganze Gesellschaft von unüberwindlichem, elementarem Grauen vor diesen unerhörten Nöten ergriffen.
Die Flucht aus der Sternenstadt begann. Anfangs beeilten sich einige aus der Zahl der hervorragenden Beamten, Direktoren, Mitgliedern der gesetzgebenden Kammer und des Stadtrates, ihre Familien in die südlichen Städte Australiens oder nach Patagonien zu schicken. Nach ihnen kam dann die zufällig angereiste Bevölkerung: Ausländer, die sehr gerne „die allerlustigste Stadt der Südhemisphäre“ besuchten, Artisten aller Professionen, Abenteurer verschiedenster Art, Frauen von leichter Aufführung. Als die Epidemie trotzdem neue Fortschritte machte, flohen auch die Kaufleute. Ihre Waren verkauften sie eiligst und ihre Magazine überließen sie dem Schicksale. Gleichzeitig mit ihnen flohen die Bankiers, die Besitzer von Theatern und Restaurants, die Herausgeber von Zeitungen und Büchern. Endlich trat die Notwendigkeit auch an die Stammbevölkerung heran. Nach dem Gesetze durften die gewesenen Arbeiter die Republik nicht ohne eine besondere Erlaubnis verlassen, unter Androhung des Verlustes der Pension. Doch um sein Leben zu retten, kümmerte sich keiner mehr um diese Drohung. Man desertierte. Es flohen die in den staatlichen Behörden dienenden, es flohen die Glieder der Volksmiliz, es flohen die Schwestern in den Krankenhäusern, die Pharmazeuten, die Ärzte. Das Bestreben zu fliehen, wurde seinerseits fast zur Manie. Es flohen alle, die fliehen konnten.
Die Stationen der elektrischen Bahnen waren beständig von riesigen Volksmengen umlagert. Die Billette zu den Zügen wurden für enormes Geld gekauft, und es wurde um sie gekämpft. In der Minute der Abfahrt des Zuges brachen neue Menschen in die Waggons und traten die eroberten Plätze nicht ab. Die Menschen hielten die nur für Kranke bestimmten Züge an, zogen sie aus den Waggons, nahmen ihre Zellen ein und zwangen den Maschinisten zu fahren. Der ganze bewegliche Bestand an Eisenbahnen in der Republik arbeitete seit Ende Mai nur auf den Linien, welche die Hauptstadt mit den Häfen verbanden. Die aus der Sternenstadt kommenden Züge waren überfüllt; die Passagiere standen in den Gängen, wagten es sogar, draußen zu stehen, obgleich bei der Schnelligkeit der heutigen elektrischen Bahnen die Gefahr des Erstickungstodes drohte. Die Dampferkompagnien Australiens, Südamerikas und Südafrikas machten verhältnismäßig gute Geschäfte bei der Überfahrt der Emigranten aus der Republik in andere Länder. Zur Sternenstadt aber fuhren die Züge fast leer. Für kein Geld konnte man Menschen bereit finden, einen Dienst in der Hauptstadt zu übernehmen; nur zuweilen besuchten exzentrische Touristen und Liebhaber starker Emotionen die verseuchte Stadt. Man hat berechnet, daß vom Beginn der Emigrierung bis zum 22. Juni, als der regelmäßige Bahnverkehr aufhörte, etwa 1500000 Menschen die Sternenstadt auf den sechs Bahnlinien verließen, also fast zwei Drittel der gesamten Einwohnerschaft.
In dieser Zeit hat sich der Vorsitzende des Stadtrates, Horace Divile, durch seine Unternehmungslust, Willenstärke und Männlichkeit ewigen Ruhm erworben. In der Extrasitzung vom 5. Juni übertrug der Stadtrat im Einvernehmen mit der Kammer und dem Rate der Direktoren dem Divile die diktatorische Gewalt über die Stadt mit dem Titel des Befehlhabers, übergab ihm die Stadtkasse zur Verfügung, die Volksmiliz und die städtischen Unternehmungen. Hierauf wurden die Regierungsinstitutionen und das Archiv aus der Sternenstadt in den Nordischen Port übergeführt. Der Name Horace Divile müßte mit goldenen Buchstaben zu den alleredelsten Namen der Menschheit geschrieben werden. Im Verlauf von 1 ½ Monaten kämpfte er unablässig mit der fortschreitenden Anarchie in der Stadt. Ihm gelang es, sich eine Schar mutiger Gehilfen zu bilden. Ihm gelang es unter der Volksmiliz und den städtischen Beamten, die das Grauen vor der allgemeinen Not ergriffen hatte, und deren Zahl durch die Epidemie fortwährend dezimiert wurde, noch lange die Disziplin und Subordination aufrecht zu erhalten. Hunderttausende verdanken Horace Divile ihre Rettung, da es ihnen nur dank seiner Energie und seinen Anordnungen abzureisen gelang. Anderen Tausenden von Menschen erleichterte er die letzten Tage, gab ihnen die Möglichkeit im Krankenhause bei guter Pflege und nicht unter den Schlägen der entmenschten Menge zu sterben. Ferner hat Divile der Menschheit die Chronik dieser Katastrophe erhalten, denn nicht anders kann man diese kurzen aber inhaltsreichen und genauen Telegramme nennen, die er täglich und auch mehreremale am Tage aus der Sternenstadt nach der zeitweiligen Residenz der republikanischen Regierung beförderte: nach dem Nordischen Port.
Bei Übernahme des Postens eines Stadtbefehlshabers war Diviles erstes Werk der Versuch, die aufgeregten Gedanken der Bevölkerung zu beruhigen. Er gab Manifeste heraus, die darauf hinwiesen, daß die psychische Ansteckung am ehesten auf erregte Menschen wirke, und welche die gesunden und gemütsstarken Leute aufforderte, auf die Schwachen und Nervösen den Einfluß ihrer Autorität geltend zu machen. Gleichzeitig trat Divile in Verbindung mit der „Gesellschaft zur Bekämpfung der Epidemie“ und verteilte unter deren Mitglieder alle öffentlichen Orte, Theater, Versammlungen, Märkte, Straßen. In diesen Tagen verging kaum eine Stunde, in der nicht an irgend einem Orte eine Erkrankung konstatiert wurde. Bald hier, bald dort bemerkte man Menschen, oder ganze Gruppen von Menschen, deren Benehmen offenkundig ihre Abnormität bewies. Größtenteils hatten die Kranken, die ihren Zustand erkannten, den unmittelbaren Wunsch, jemand um Hilfe anzugehen. Aber unter dem Einfluß ihrer gestörten Psychen verwandelte sich dieser Wunsch in feindliche Handlungen gegen die in der Nähe Weilenden. Die Kranken wollten zu sich nach Hause laufen oder ins Krankenhaus, flohen aber statt dessen in die entfernten Stadtviertel. Ihnen kam der Gedanke, jemand um Trost zu bitten, statt dessen packten sie die zufällig Vorübergehenden an die Gurgel, würgten sie, schlugen und verwundeten sie oft mit Messer oder Stock. Deshalb flohen alle Menschen, sobald sich jemand in der Nähe zeigte, der vom „Widerspruch“ befallen war. In solchen Minuten kamen die Mitglieder der „Gesellschaft“ zu Hilfe. Einige von ihnen überwältigten den Kranken, beruhigten ihn und transportierten ihn in das nächstliegende Krankenhaus; die anderen beruhigten die Menge und erklärten ihr, daß keine Gefahr vorhanden sei, daß nur ein neues Unglück geschehen wäre, mit dem alle nach dem Maße ihrer Kraft zu kämpfen hätten.
In den Theatern und Versammlungen führten die Fälle plötzlicher Erkrankungen sehr oft zu tragischen Endspielen. Anstatt den Sängern ihr Entzücken auszudrücken, stürzten einige hundert Zuschauer, die in der Oper von plötzlichem Massenwahnsinn ergriffen wurden, plötzlich auf die Szene und prügelten die Darsteller. Ein Artist, dessen Rolle mit einem Selbstmorde schließen mußte, schoß in einem Anfall plötzlicher Erkrankung im großen dramatischen Theater mehrere Male in den Zuschauerraum. Der Revolver war natürlich nicht geladen. Doch unter der Einwirkung dieser Nervenerschütterung brach bei mehreren Personen im Publikum die Krankheit, die sie schon heimlich ergriffen hatte, offen aus. Bei dem entstehenden Gewühl, während dessen die natürliche Panik durch die Handlungen der „Widerspruchsvollen“ noch verstärkt wurde, wurden an 100 Menschen getötet. Doch am allerfurchtbarsten war das Ereignis im „Feuerwerktheater“. Die dorthin zur Beaufsichtigung des Feuers gesandte Truppe der Stadtmiliz zündete in einem Anfall der Krankheit die Szenerie an, sowie jene Schleier, welche die Lichteffekte verteilen. Vom Feuer und im Gedränge kamen nicht weniger als 200 Menschen um. Nach diesem Geschehnis verbot Horace Divile alle theatralischen oder musikalischen Ausübungen in der Stadt.
Eine für die Einwohner furchtbare Gefahr bildeten die Räuber und Diebe, die bei der allgemeinen Desorganisation ein weites Feld für ihre Tätigkeit fanden. Man beteuert, daß einige von ihnen erst zu dieser Zeit in die Sternenstadt aus dem Auslande gekommen seien. Um unbestraft zu bleiben, simulierten einige Wahnsinn. Andere hielten es nicht einmal für nötig, den offenen Raub durch Heuchelei zu bemänteln. Die Räuberbanden brachen in die verlassenen Magazine und trugen die wertvolleren Sachen fort, drangen in die Privatquartiere und verlangten Gold, hielten die Passanten an und nahmen ihnen ihre Kostbarkeiten, Ringe, Uhren, Bracelets fort. Zu den Räubereien gesellten sich Gewalttaten jeder Art und vornehmlich Vergewaltigungen der Frauen. Der Stadtbefehlshaber entsandte ganze Abteilungen der Miliz gegen die Verbrecher, aber diese erkühnten sich, in offenen Kampf zu treten. Es gab furchtbare Vorfälle, wenn unter den Räubern oder den Miliztruppen plötzlich am „Widerspruch“ Erkrankte auftauchten und ihre Waffen gegen die Kameraden wandten. Die arretierten Räuber sandte der Befehlshaber anfangs aus der Stadt. Doch die Bürger befreiten sie aus ihren Waggonzellen, um ihre Plätze einzunehmen. Da fühlte sich der Befehlshaber genötigt, die Straßenräuber und alle Gewalttätigen zum Tode zu verurteilen. So wurde nach einer fast 300jährigen Unterbrechung auf der Erde aufs neue die unverhüllte Todesstrafe eingeführt.
Im Juni begann in der Stadt ein Mangel an Gegenständen der ersten Notdurft fühlbar zu werden. Die Lebensmittel reichten nicht aus und ebensowenig die Medikamente. Die Zufuhr auf der Eisenbahn begann sich zu vermindern; in der Stadt selbst hatte fast jegliches Gewerbe aufgehört. Divile organisierte städtische Brotbäckereien und verteilte an alle Einwohner Brot und Fleisch. In der Stadt wurden allgemeine Speisesäle nach dem Muster jener auf den Fabriken eröffnet. Doch es war unmöglich, Arbeiter in genügender Zahl zu finden. Die freiwillig Arbeitenden mühten sich bis zur Erschöpfung, doch ihre Zahl wurde stets kleiner. Die Krematorien hatten den ganzen Tag zu tun, doch die Zahl der Leichname in den Grabkammern wurde nicht geringer, sondern wuchs, und schon wurden auf den Straßen und in den Privatquartieren Leichen aufgefunden. Die städtischen zentralen Unternehmungen, der Telegraph, das Telephon, die Beleuchtung, Wasserleitung, Kanalisation, wurden von einer stets kleiner werdenden Zahl von Menschen bedient. Erstaunlich war es, wie Divile überall hingelangte. Alles verfolgte er, alles leitete er. Nach seinen Berichten kann man denken, daß er keine Ruhe kannte. Und alle, die sich aus der Katastrophe gerettet haben, bezeugen einstimmig, daß seine Tätigkeit über alles Lob erhaben war.
Mitte Juni begann es an Eisenbahnbeamten zu mangeln. Es waren zu wenig Maschinisten und Kondukteure da, um die Züge zu bedienen. Am 17. Juni fand auf der Südwestlinie die erste Eisenbahnkatastrophe statt, deren Ursache ein am „Widerspruch“ erkrankter Maschinist war. In einem Anfall der Krankheit stürzte der Maschinist den Zug aus dreißigfüßiger Höhe auf das Eisfeld herab. Fast alle Passagiere wurden getötet oder verstümmelt. Die Nachricht von diesem Fall brachte der nächste Zug in die Stadt und sie wirkte wie ein Donnerschlag. Sofort wurde ein Sanitätszug ausgesandt. Er brachte die Leichen und die verstümmelten halblebendigen Körper zurück. Doch am Abend desselben Tages verbreitete sich bereits die Nachricht, daß eine analoge Katastrophe auch auf der ersten Linie geschehen sei. Nun waren bereits zwei der Eisenbahnlinien, welche die Sternenstadt mit der Welt verbanden, untauglich. Natürlich wurden aus der Stadt, sowie aus dem Nordischen Port Abteilungen zur Ausbesserung der Bahnen gesandt, doch im Winter ist es in jenen Gebieten fast unmöglich, zu arbeiten. Diese zwei Katastrophen waren nur Vorläufer der nun folgenden. Mit je mehr Furcht die Maschinisten an ihre Sache traten, desto sicherer wiederholten sie das Vergehen ihrer Vorgänger in einem Anfall der Krankheit. Eben darum, weil sie sich fürchteten, ein Unglück herbeizuführen, führten sie es herbei. Vom 18. bis zum 22. Juni, also in 5 Tagen, wurden sieben Eisenbahnzüge, die alle voller Menschen waren, in die Abgründe gestürzt. Tausende von Menschen fanden dort ihren Tod, da sie entweder zerschmettert wurden oder in Schneewüsten Hungers starben. Nur sehr wenige Menschen fanden die Kraft, zur Stadt zurückzukehren. Die sechs Magistralen (so hießen die elektrischen Bahnen), welche die Sternenstadt mit der Welt verbanden, waren untauglich geworden, die etwa 600000 Menschen zählende Einwohnerschaft der Stadt war von der ganzen übrigen Menschheit abgeschnitten. Einige Zeit hindurch verband sie nur noch der Telegraphendraht.
Am 24. Juni wurde der Verkehr auf der Stadtmetropolitaine eingestellt, da es an Beamten mangelte. Am 26. Juni wurde der Dienst am Stadttelephon eingestellt. Am 27. Juni wurden alle Apotheken außer der zentralen geschlossen. Am 1. Juli ordnete der Befehlshaber an, daß alle Einwohner in die Zentralteile der Stadt übersiedeln und die Peripherien verlassen müßten, damit die Aufrechterhaltung der Ordnung, sowie das Verteilen der Lebensmittel und die ärztliche Hilfeleistungen leichter vor sich gehen könnten. Die Leute verließen ihre Quartiere und bezogen fremde, von ihren Besitzern verlassene Wohnungen. Das Gefühl des Eigentums verschwand. Keinem tat es leid, das seine zu verlassen, keinem kam es eigentümlich vor, fremdes zu benutzen. Übrigens fanden sich noch immer Marodeure und Räuber, die man schon eher als Psychopathen bezeichnen muß. Sie setzten ihr Plündern noch weiter fort und man findet gegenwärtig nicht selten in den leeren Sälen verlassener Häuser ganze Schätze von Gold und Kostbarkeiten, in deren Nähe der halbverfaulte Leichnam des Räubers liegt.
Es ist bemerkenswert, daß trotz des allgemeinen Ruins das Leben dennoch seine gewöhnlichen Formen beibehielt. Es fanden sich noch Kaufleute, die Magazine eröffneten und aus irgend welchen Gründen ihre der Plünderung entgangenen Waren zu unerhörten Preisen verkauften: Leckereien, Blumen, Bücher, Gewehre . . . . . Ohne zu murren, gaben die Käufer ihr unnütz gewordenes Gold fort, welches die geizigen Kaufleute dann törichterweise versteckten. Noch gab es heimliche Freudenhäuser mit Karten, Getränken, Lastern, wohin die Unglückseligen strömten, um dort die furchtbare Wirklichkeit zu vergessen. Die Kranken vermischten sich dort mit Gesunden und keiner hat die Chronik der Greuelszenen, die dort vor sich gingen, geschrieben. Noch erschienen zwei oder drei Zeitungen, deren Herausgeber bemüht waren, die Bedeutung des literarischen Wortes in dem allgemeinen Verfall ringsum aufrecht zu erhalten. Die Nummern dieser Zeitungen, die schon heute mit dem zehn- und zwanzigfachen ihres Anfangspreises bezahlt werden, müssen einst die größten bibliographischen Seltenheiten werden. In diesen Textspalten, die inmitten des herrschenden Wahnsinns geschrieben und von halbverrückten Setzern gesetzt wurden, ist ein lebendiges und furchtbares Bild all dessen enthalten, was die unglückliche Stadt erlebte. Es fanden sich Reporter, die über Stadtereignisse berichteten; Schriftsteller, welche die Sachlage erregt erörterten, und sogar Feuilletonisten, die in diesen Tagen der Tragik zu erheitern versuchten, aber die Telegramme, die aus anderen Ländern kamen, von wirklichem gesunden Leben sprachen, die mußten die Seelen der Leser, welche dem Untergang geweiht waren, mit Verzweiflung erfüllen. Man machte hoffnungslose Rettungsversuche. Anfang Juli beschloß eine riesige Menge von Männern, Frauen und Kindern, die von einem gewissen John Lew geführt wurde, zu Fuß den nächsten besiedelten Platz Lundontown zu erreichen. Divile begriff die Torheit ihres Vorhabens, konnte sie aber nicht zurückhalten und mußte sie sogar mit warmer Kleidung und Lebensmitteln versorgen. Dieser ganze Trupp, es waren etwa 2000 Menschen, verirrte sich und verdarb in den Schneewüsten des Polarlandes, umgeben von schwarzer, sechs Monate währender Nacht. Ein gewisser Whiting begann ein anderes mehr heroisches Mittel zu predigen. Er schlug vor, alle Kranken zu töten, in der Annahme, daß alsdann die Epidemie aufhören würde. Er fand nicht wenig Anhänger, obgleich übrigens in jenen dunklen Tagen selbst der allerwahnsinnigste, allerunmenschlichste Vorschlag, sofern er nur Rettung versprach, Anhänger gefunden hätte. Whiting und seine Freunde durchsuchten die ganze Stadt, brachen in alle Häuser und töteten alle Kranken. In den Krankenhäusern vollführten sie Massenschlächtereien. In der Ekstase schlugen sie auch jene tot, die nur im Verdacht standen, nicht ganz gesund zu sein. Zu diesen Ideenmördern gesellten sich Wahnsinnige und Räuber. Die ganze Stadt verwandelte sich in eine Arena des Kampfes. In diesen schweren Tagen bildete Horace Divile aus seinen Mitarbeitern eine Truppe und begeisterte sie persönlich zum Kampf mit den Anhängern des Whiting. Mehrere Tage währte die Verfolgung. Hunderte von Menschen fielen auf dieser und jener Seite. Zum Schluß wurde Whiting selbst gefangen genommen. Er wurde als im letzten Stadium der mania contradicens befunden und darum nicht zur Hinrichtung geführt, sondern ins Krankenhaus, wo er auch bald darauf verschied.
Am 8. Juli traf die Stadt einer der härtesten Schläge. Die Beamten, welche die Tätigkeit der elektrischen Zentralstation beaufsichtigten, zerbrachen in einem plötzlichen Anfall der Krankheit alle Maschinen. Das elektrische Licht versagte und die ganze Stadt, alle Straßen, alle Wohnungen tauchten in absolute Finsternis. Da die Stadt keine Beleuchtung und keine Beheizung außer der elektrischen kannte, so befanden sich jetzt alle Einwohner in absolut hilfloser Lage. Divile hatte eine solche Gefahr vorausgesehen. Er hatte ganze Lager von Pechfackeln und Beheizungsmaterial hergerichtet. Auf allen Straßen wurden Scheiterhaufen aufgestellt. Die Einwohner erhielten Fackeln zu Tausenden, doch diese kümmerliche Beleuchtung konnte unmöglich die gigantischen Perspektiven der Sternenstadt erhellen, die sich oft 10 km lang in geraden Linien und in der furchtbaren Höhe von 30 Etagen hinzogen. Mit Ausbruch der Finsternis floh die letzte Disziplin aus der Stadt. Alle Seelen wurden von Entsetzen und Wahnsinn erfaßt. Die Gesunden konnte man nicht mehr von den Kranken unterscheiden. Es begannen die furchtbaren Orgien der verzweifelten Menschen.
Mit erstaunlicher Schnelligkeit trat bei allen das Schwinden des sittlichen Gefühles zutage. Alle Kultur fiel von diesen Leuten ab, gleich einer dünnen, wenn auch jahrtausend alten Rinde, und sie waren wie jene wilden Menschen, Tiermenschen, die damals noch auf der jungfräulichen Erde lebten. Jeder Begriff von Recht verschwand, — nur die Kraft wurde anerkannt. Für die Frauen wurde der Durst nach Befriedigung das einzige Gesetz. Die allerbescheidensten Familienmütter führten sich wie Prostituierte auf, gingen willig von einer Hand in die andere über und redeten die unanständige Sprache der Freudenhäuser. Die Mädchen liefen auf die Straße, boten ihre Unschuld öffentlich aus, führten ihren Erkorenen in die nächste Türe und gaben sich ihm auf dem fremden Bette eines Unbekannten. Die Trinker veranstalteten in den zerstörten Kellern Feste, gar nicht darauf achtend, daß in ihrer Mitte oftmals unbestattete Leichname lagen. Das alles wurde durch die Anfälle der noch immer grassierenden Krankheit noch mehr kompliziert Furchtbar war die Lage der von ihren Eltern dem Schicksal überlassenen Kinder. Einige wurden von lasterhaften Elenden vergewaltigt, andere von Anhängern des Sadismus, die es plötzlich in großen Mengen gab, gefoltert. Die Kinder starben in ihren Kinderzimmern vor Hunger oder vor Scham und Schmerzen nach der Vergewaltigung; viele wurden auch absichtlich oder zufällig getötet. Manche behaupten sogar, daß sich Unholde gefunden hätten, welche die Kinder fingen, um an ihrem Fleische ihre wiedererwachten Menschenfresserinstinkte zu befriedigen.
Während dieser letzten Periode der Tragödie konnte Horace Divile natürlich nicht der ganzen Bevölkerung helfen. Im Gebäude des Rathauses eröffnete er für alle, die noch ihren Verstand bewahrt hatten, ein Asyl. Der Eingang ins Gebäude wurde verbarrikadiert und beständig bewacht. Innen waren Proviant und Wasser für dreitausend Menschen auf 40 Tage hergerichtet. Doch um Divile sammelten sich nur etwa 1800 Männer und Frauen. Natürlich waren in der Stadt wohl auch noch mehr Menschen mit ungetrübter Erkenntnis, doch kannten sie Diviles Asyl nicht, und verbargen sich in ihren Häusern. Viele wagten nicht, auf die Straße zu gehen, und man findet jetzt in einigen Zimmern zuweilen Leichname von Menschen, die in der Einsamkeit Hungers starben. Es ist bemerkenswert, daß unter den ins Rathaus Geflüchteten sehr wenig Fälle der Erkrankung am „Widerspruch“ vorkamen. Divile verstand es, die Disziplin in seiner kleinen Gemeinde aufrecht zu erhalten. Bis zum letzten Tage führte er ein Journal aller Vorgänge und dieses Journal ist zusammen mit den Telegrammen Diviles wohl die beste Quelle, aus der wir unsere Kenntnisse von der Katastrophe schöpfen können. Dieses Journal wurde in einem Geheimschrank des Rathauses, zusammen mit besonders wertvollen Dokumenten aufgefunden. Die letzte Nachricht datiert vom 20. Juli. Divile berichtet in ihr, daß eine wahnwitzige Menge den Sturm aufs Rathaus begonnen habe und daß er genötigt wäre, den Angriff mit Revolversalven abzuschlagen. „Worauf ich hoffe,“ schreibt Divile, „weiß ich nicht. Vor dem Frühling Hilfe zu erwarten, ist undenkbar. Bis zum Frühjahr kann ich mich mit den Vorräten, die in meinen Händen sind, unmöglich halten. Doch ich werde bis zuletzt meine Pflicht erfüllen.“ Dies sind die letzten Worte Diviles. Welch edle Worte!
Es ist anzunehmen, daß am 21. Juli die Menge das Rathaus im Sturmangriff einnahm, und daß seine Verteidiger entweder getötet oder vertrieben wurden. Diviles Leichnam ist zurzeit noch nicht aufgefunden würden. Wir haben keine einigermaßen glaubwürdigen Nachrichten über das, was in der Stadt nach dem 21. Juli vorging. Nach den Spuren, die man jetzt bei der Reinigung der Stadt findet, ist anzunehmen, daß die Anarchie ihre äußerste Grenze erreichte. Man kann sich die Flucht halbdunkler Straßen vorstellen, beleuchtet vom Gewitterschein der Scheiterhaufen, die aus Stößen von Möbeln und Büchern errichtet waren. Feuer erhielt man, indem man Feuerstein auf Eisen schlug. Um die Scheiterhaufen drängten sich in wilder Fröhlichkeit die Scharen von Wahnwitzigen und Betrunkenen. Ein großer Becher machte die Runde. Dort tranken Männer und Frauen. Dort geschahen Szenen viehischer Sinnlichkeit. Dunkle atavistische Gefühle erwachten in den Instinkten dieser Stadtbewohner, und die Halbnackten, Ungewaschenen, Ungekämmten tanzten in Reigen die Tänze ihrer fernen Vorfahren, die noch Zeitgenossen der Höhlenbären waren, und sangen dieselben wilden Lieder, welche die Horden sangen, wenn sie mit ihren Steinbeilen das Mammut anfielen. Mit den Liedern, dem sinnlosen Geschwätz, dem idiotischen Lachen vermengten sich die Wahnsinnsschreie der Kranken, die schon die Möglichkeit verloren hatten, ihre Fieberträume in Worten auszudrücken, und das Stöhnen der Sterbenden, die sich dort selbst inmitten schon zerfallender Leichname wälzten. Zuweilen wurde der Tanz von einer Prügelei unterbrochen, um ein Faß Wein, um ein schönes Weib oder auch ganz ohne Anlaß in einem jener Wahnsinnsanfälle, die zu sinnlosen, widerspruchsvollen Handlungen trieben. Entfliehen konnte man nicht; überall waren dieselben Greuelszenen, dieselben Orgien, Kämpfe, dieselbe tierische Lust, tierische Wut — oder die absolute Finsternis, die noch furchtbarer zu sein schien und der erregten Einbildung noch unerträglicher.
In diesen Tagen war die Sternenstadt ein ungeheurer großer Kasten, in dem noch einige tausende lebender menschenähnlicher Wesen im Gestanke von hunderttausend Leichnamen vegetierten, wo es unter den Lebenden schon keinen mehr gab, der seine Lage begriffen hätte. Dies war die Stadt der Verrückten, ein gigantisches Irrenhaus, das größte und abscheulichste Bedlam, das je die Welt gesehen. Und diese Verrückten rotteten einander aus, erdolchten einander, bissen sich die Gurgeln durch, oder starben vor Wahnsinn, starben vor Grauen, starben vor Hunger und an all jenen Krankheiten, deren Miasmen die verseuchte Luft beherrschten.
Es versteht sich, daß die Regierung der Republik durchaus nicht gleichmütig dem furchtbaren Unglück, das die Hauptstadt betroffen hatte, zuschaute. Doch schon sehr bald mußte man jeglicher Hoffnung, Hilfe zu bringen, entsagen. Ärzte, Diakonissinnen, Militärs, Beamte jeder Art — alles weigerte sich, in die Sternenstadt zu fahren. Nach der Einstellung der elektrischen Bahnfahrten war jede direkte Verbindung mit der Stadt unterbrochen, da das rauhe örtliche Klima keine anderen Verkehrswege gestattete. Außerdem wurde die Aufmerksamkeit der Regierung bald schon auf Erkrankungsfälle am „Widerspruch“ gelenkt, die in anderen Städten der Republik auftraten. In einigen von ihnen drohte die Krankheit gleichfalls epidemischen Charakter anzunehmen und es begann eine allgemeine Panik, die den Ereignissen in der Sternenstadt ähnelte. Dies führte zu einer Emigrierung der Einwohner aus allen bewohnten Punkten der Republik. Auf allen Fabriken wurde die Arbeit eingestellt und das ganze Handelsleben des Landes erlosch. Doch dank den energischen Maßnahmen, die in den anderen Städten zeitig getroffen wurden, gelang es, die Epidemie zum Stillstand zu bringen, und nirgends erreichte sie einen solchen Umfang wie in der Hauptstadt.
Es ist bekannt, mit welcher aufgeregten Aufmerksamkeit die ganze Welt das Unglück der jungen Republik verfolgte. Im Beginne, als noch niemand das bis zu so unerhörter Ausdehnung erfolgende Anwachsen des Elendes erwartete, war die Neugierde das herrschende Gefühl. Die hervorragenden Blätter aller Länder (darunter auch unser „Nord-Europäisches Abendblatt“) entsandten in die Sternenstadt ihre Spezialkorrespondenten zum Berichterstatten über den Gang der Epidemie. Viele dieser tapfern Ritter von der Feder wurden ein Opfer ihrer professionellen Pflicht. Kaum aber, daß Nachrichten bedrohlichen Charakters auftauchten, boten sofort die Regierungen verschiedener Staaten sowie die Privatgesellschaften der republikanischen Regierung ihre Hilfe an. Die einen entsandten Truppen, die andern formierten Escadres von Ärzten, die dritten trugen Geldspenden bei, aber die Ereignisse entwickelten sich mit solcher Vehemenz, daß der größte Teil dieser Operationen nicht zur Ausführung kam. Nach der Einstellung des Eisenbahnverkehrs kamen als einzige Lebensnachrichten von der Sternenstadt nur die Telegramme des Befehlshabers. Diese Telegramme wurden sofort an alle Weltenden versandt und dort in Millionen von Exemplaren verbreitet. Nachdem die elektrischen Maschinen zerbrochen waren, funktionierte der Telegraph noch einige Tage, da sich auf der Station einige geladene Akkumulatoren vorfanden. Der genaue Grund, weswegen die telegraphische Verbindung völlig abbrach, ist bisher unbekannt: vielleicht waren die Apparate beschädigt. Das letzte Telegramm Horace Diviles trägt das Datum des 27. Juni. Von diesem Tage ab blieb die Menschheit fast 1 ½ Monate lang ohne jede Nachricht aus der Hauptstadt der Republik.
In den letzten Tagen des August erreichte der Äronaut Thomas Billie auf seiner Flugmaschine die Sternenstadt. Er fand auf dem Dach der Stadt zwei Menschen, die längst schon den Verstand verloren hatten und vor Kälte und Hunger halbtot waren. Durch die Ventilatoren sah Billie, daß die Straßen in absoluter Dunkelheit lagen, hörte aber auch wilde Schreie, die bewiesen, daß noch Lebewesen in der Stadt wären. In die Stadt selbst wagte Billie sich nicht herunter. Anfang September gelang es, die eine Linie der elektrischen Eisenbahn bis zur Station Lissis, die nur 105 km von der Stadt abliegt, wieder herzustellen. Ein Trupp gutbewaffneter, mit ausreichendem Proviant und den Mitteln für die ersten Hilfeleistungen versehener Leute gelangte durch das nordwestliche Tor in die Stadt. Diese Truppe konnte sich allerdings infolge des furchtbaren Gestankes, der die Luft erfüllte, nicht über die ersten Quartale hinauswagen. Sie mußten faktisch Schritt für Schritt machen, die Straßen von Leichnamen säubern und die Luft durch künstliche Mittel reinigen. Die Menschen, die sie in der Stadt noch lebend antrafen, waren bis zur Unkenntlichkeit entstellt. In ihrer Wildheit glichen sie bösen Tieren und mußten mit Gewalt eingefangen werden. Endlich, es war etwa Mitte September, gelang es, eine regelmäßige Verbindung mit der Sternenstadt herzustellen, und konnte man mit der systematischen Renovierung beginnen.
Gegenwärtig ist der größte Teil der Stadt bereits von Leichnamen gesäubert. Die elektrische Beleuchtung und Beheizung sind wieder hergestellt. Unbesetzt sind bisher nur noch die Amerikanischen Quartale, doch man nimmt an, daß in ihnen keine Lebewesen sind. Im ganzen sind gegen 10000 Menschen gerettet, doch der größte Teil von ihnen hat eine unheilbare psychische Störung erlitten. Die, welche mehr oder weniger wieder genesen, sprechen nur höchst ungern von dem, was sie überlebten und von den grauenhaften Tagen. Zudem sind ihre Erzählungen voller Widersprüche und werden sehr oft vom dokumental Gegebenem nicht bestätigt. An verschiedenen Orten hat man Nummern der Zeitungen aufgefunden, die in der Stadt noch bis Ende Juli erschienen. Die letzte bis jetzt aufgefundene, vom 22. Juli datierte, enthält die Nachricht vom Tode Horace Diviles und den Aufruf, das Asyl im Rathaus wiederherzustellen. Allerdings wurde noch ein Blättchen gefunden, das vom August datiert, doch dessen Inhalt ist derart, daß man den Autor (der vermutlich seinen Irrsinn selbst gesetzt hat) entschieden für unzurechnungsfähig erklären muß. Im Rathaus wurde das Tagebuch Horace Diviles entdeckt, das in folgerichtiger Ordnung die Chronik der Ereignisse in in jenen drei Wochen vom 28. Juni bis zum 20. Juli enthält. Nach den furchtbaren Funden, die man auf den Straßen und im Innern der Häuser gemacht hat, kann man sich eine klare Vorstellung von jenen Ungeheuerlichkeiten machen, die in den letzten Tagen in der Stadt geschahen. Überall sind furchtbar verstümmelte Leichen: Menschen, die des Hungertodes starben, Menschen, die gemartert und erwürgt wurden, Menschen, die von Wahnsinnigen in Anfällen der Ekstase getötet wurden, und endlich — benagte Körper. Die Leichen findet man in den allerunerwartetsten Orten: im Tunnel der Metropolitaine, in den Kanalisationsröhren, in unterschiedlichen Koffern, in Kesseln: überall suchten die ihres Verstandes beraubten Einwohner Rettung vor dem sie umgebenden Entsetzen. Das Innere fast aller Häuser ist zerstört und die Immobilien, die den Plünderern nutzlos erschienen, findet man in geheimen Zimmern und unterirdischen Räumen versteckt.
Zweifellos werden bis zur Wiederbewohnbarkeit der Sternenstadt noch einige Monate vergehen. Gegenwärtig ist sie fast leer. Die Stadt, die gegen drei Millionen Menschen beherbergen kann, wird augenblicklich von etwa 30000 Arbeitern bewohnt, die mit der Säuberung von Straßen und Häusern beschäftigt sind. Übrigens kamen auch einige der früheren Einwohner an, um die Leichen ihrer Verwandten aufzusuchen und die Reste ihres vernichteten oder gestohlenen Eigentums zu sammeln. Zugereist sind auch einige Touristen, die das ausschließliche Schauspiel der verwüsteten Stadt hingelockt hat. Zwei Unternehmer haben bereits zwei Hotels eröffnet, die schon recht flotte Geschäfte machen. In kurzer Zeit wird auch ein kleines Café chantant eröffnet werden, für welches die Truppe bereits engagiert ist.
Das „Nord-Europäische Abendblatt“ hat seinerseits einen neuen Korrespondenten, Herrn Andrew Ewald, in die Stadt gesandt und wird in genauen Berichten die Leser mit allen neuen Entdeckungen bekannt machen, die in der unglücklichen Hauptstadt der Republik des Südkreuzes gemacht werden sollten.
Ein unaufgeklärter Fall
 Ferne erstarb der Glockenton, zerschmolz fast klagend,
so daß es bald schwer wurde, zu unterscheiden,
ob man ihn noch höre, oder ob er nur
in der Erinnerung klänge.
Ferne erstarb der Glockenton, zerschmolz fast klagend,
so daß es bald schwer wurde, zu unterscheiden,
ob man ihn noch höre, oder ob er nur
in der Erinnerung klänge.
Langsam und schweigend kehrten die Schwestern in den Saal zurück. Keine sah die andere an. Wußten nicht, was zu sprechen.
Noch standen auf dem Tische die Reste des vor kurzem beendeten traurigen Abendbrotes, eine kaum angebrochene Weinflasche, ein kalt gewordener Teekessel.
Lydia wagte es, zu sprechen:
— Kett, willst du nicht Tee? Ich glaube, du trankst noch nicht.
Mara zuckte nervös mit den Achseln. Kett schüttelte den Kopf.
Alle drei setzten sich, schwiegen, dachten an dasselbe. Dachten an ein Schneefeld und an ein Dreigespann, das schnell über die Wege frischen Schnees dahinbraust; dachten an ein Stationsgebäude, das ganz in Lichtern steht; hörten schon das gleichmäßige Räderrollen, das sich immer, kaum daß die Wange sich an das harte Polster des Waggons gelehnt hat, so sehr mit den ersten Bildnissen des Traumes vermischt . . . . Dann dachten sie an das ferne Paris, an breite und helle Plätze, an bunte, schwirrende Boulevards. Dachten daran, daß Nikolai nun nie wieder zurückkäme.
Und in jeder Seele erhob sich das Gefühl kraftloser zu später Reue, schwoll an wie Wasser, strömte über: das quälendste aller Gefühle. Und in den drei verschiedenen Sprachen dreier verschiedener Seelen sprachen sie, sagten sich selbst, sagten sich die gleichen Worte: wie es möglich war, diesen letzten Augenblick vorübergehen zu lassen. Wie es möglich war, nicht den letzten, und sei es verzweifelten Versuch zu wagen? Wie, wenn man eilen würde, ihn ereilen, etwas sagen, etwas ausführen? . . . Oder ist es schon zu spät? Zu spät? Zu spät?
Die Schwestern schwiegen, doch es war ihnen, als tauschten sie nichtssagende Worte aus. Und vielleicht tauschten sie auch nichtssagende Worte aus und es war ihnen nur, als wenn sie schwiegen.
Draußen begann der Schnee zu wirbeln. Und im Netz der wehenden Schneeflocken war noch verwischter die Biegung des Weges und der Abhang mit dem schwärzlichen Zaune jungen Fichtenwaldes und weiterhin rechts die Ferne leblosen Feldes.
Irgend eine Zeit verging. Und es wäre ein Tropfen genug gewesen, zu fallen in dies Gefäß der Hoffnungslosigkeit, ein Wort, ein Anstoß, damit diese drei Frauen aufspringen würden mit dem Schrei des Entsetzens, hinstürzen wie ohne Gefühle oder sich aufeinander wie drei Wölfinnen werfen, um sich zu zerfleischen und mit den Krallen zu zerreißen.
Doch in gleicher Erstarrung folgten die Minuten den Minuten. Nur der Schneewirbel wurde dichter. Nur die Töne verstummten in dem Häuschen, das die Dienerschaft bewohnte.
Und jemand sagte, daß schon Mitternacht wäre.
Die Schwestern standen auf, verabschiedeten sich von einander, gingen in ihre Zimmer. Und hörbar wurde in den Zimmern das Rauschen der Kleider. Dann verstummte auch dies.
Und mit jeder waren die Nacht und ihre Gedanken.
Draußen hob der Sturm an.
Ferne erstand der Glockenton, war anfangs kaum hörbar, so daß es schwer wurde, zu unterscheiden, ob man ihn höre oder ob er nur in der Erinnerung klänge, ergoß sich langsam in die nächtliche Stille, verstärkte sich, gewann eigenen Körper. Und schon klingen die Glockentöne nah und deutlich. Das Dreigespann eilt flink auf dem Wege heran, biegt ab und schon wird auf dem frischen Schnee das dumpfe Knirschen der Schlittenkufen hörbar, und, der Freitreppe sich nähernd, hält der Kutscher die Pferde an.
Die Schwestern an der Tür sehen einander ins Gesicht. Alle drei sind bleich. Sie haben alles erraten, aber wagen nichts zu sagen. Erwarten.
Da ist der bekannte Schritt. Schon geht er durch die Vorhalle. Die Tür geht auf. Herein strömt der Winternacht harte Kälte. In seinem von Schnee silbern gewordenen Pelz steht Nikolai in der Türe.
Niemand fragt ihn. Er beeilt sich die vorbereitete auswendig gelernte Antwort zu sagen:
— Ich kam zu spät zum Zuge. Ich wollte nicht bis zum Morgen auf der Station sitzen. Ich habe mich entschlossen, morgen zu fahren. Der Abendzug ist bequemer. Und vielleicht überlege ich’s mir und fahre überhaupt nicht.
Und plötzlich stürzte Lydia weinend auf ihn zu und wollte etwas tränenerstickt sagen, ganz vergessend, daß die Schwestern sie hören. Doch leise wehrte er ab.
— Morgen will ich alles erklären; morgen. Ich bin heute sehr müde. Möge man mir ins Kabinett Wein bringen. Ich habe mich ein wenig im Froste erkältet. Und bitte regt mich nicht auf. Ich muß einige wichtige Briefe schreiben.
Kett und Mara waren in der Tiefe des Zimmers. Er blickte sie nicht an, doch er sah sie. Er fühlte die Notwendigkeit, auch ihnen etwas zu sagen, doch er hatte keine Worte.
Eine Minute lang erhob er den Kopf, doch den unbeweglichen Augen Maras begegnend, senkte er ihn wieder, und ging schweigend hinaus, glitt vorbei, verschwand in der Türe seines Kabinetts.
Lydia lief fort. Man hörte ihre geschäftige Stimme.
Kett schritt langsam im Saal auf und ab und wickelte sich in ihr dunkelhimbeerfarbenes Tuch.
Mara fühlte eine Schwüle. Sie öffnete die Türe und schritt die Freitreppe hinab. Fast erstickend zerriß sie den Kragen ihres Kleides. Der Sturm schlug ihr ins Gesicht. Die feuchten Schneeflocken zerschlugen sich an ihrer Brust und das kühle Wasser rieselte an ihrem Körper herab. Sie erbebte, aber sie zog die kalte Luft tief ein.
Der Schnee ließ den Himmel bleich erscheinen. Der Wind bewegte die kraftlosen, weißen Massen. Am Tore und über dem Zaune heulte der Sturm.
Im fernen Pferdestall sah man die schwankende Laterne des Kutschers, der die Pferde bestellte.
Nikolai saß an seinem Schreibtisch.
Alles ringsum war ihm so bekannt: die farbigen Tapeten, die Bücherreihen auf ihren Brettern, die Mappen mit den angefangenen und lang schon vergessenen Arbeiten. Es brannte die bekannte Lampe unter dem grünmetallenen Lampenschirm.
Nikolai lehnte sich tiefer in den Sessel und legte die Füße auf das Bärenfell. Er wollte denken, viel denken, immer und immer noch denken. Sich dem Gedankengange so hingeben, wie auf dem langen Wege der Schneefelder. Es lag eine physische Wollust darin, daß die Gedanken wieder so auf den vorgemerkten Wegen eilen konnten.
Natürlich dachte er daran, was schon zwei Jahre sein ganzes Leben ausmachte und seine ganze Seele erfüllte: an diese drei Frauen, an die er durch furchtbare Banden der Seligkeit und Qual gefesselt war. Und so nach einem sinnlosen Fluchtversuch, um sich wieder einer dunklen Freiheit anheimzugeben, um sein Leben an einem Punkte in zwei Teile zu teilen, ist er wieder hier, bei ihnen, und wieder haben die Tage der entrückten Stunden zu beginnen, die Tage des Jubels und der Verzweiflung. Er begriff, o er begriff heute, daß er außerhalb dieser Atmosphäre gemeinsamer Beleidigungen und Anbetungen, die sie einander entgegenbrachten, nicht leben könnte, daß er ohne sie sterben müßte, wie eine tropische Pflanze ohne Treibhaus. Er wußte, daß er auf ewig hierher zurückgekommen war.
Sein Kopf drehte sich und schmerzte, vielleicht vor Müdigkeit, vielleicht von Erkältung. Die Bilder und Gestalten der Gedanken waren so deutlich, wie sonst nur im Traum oder im Fieber. Und wie im Anfangsstadium des Traumes fühlte er sich fähig, den Wechsel der Erscheinung zu beherrschen, Gestalten herbeizurufen, wie es ein Zauberer durch die Kraft seiner Beschwörungen vermag.
Er wollte Lydias Bildnis vor sich erscheinen lassen, so wie sie in den ersten Tagen nach ihrer Hochzeit war, — ein schüchternes Mädchen, ein schamhaftes Weib, das in dem für sie Unsagbaren unvernünftig wurde. Und er sah ihr Zimmer wieder in irgend einem Hotel an der Riviera, sah deutlich, die Spitzen an den Bettkissen und in dem rosigen Licht des elektrischen Lämpchens inmitten der zerdrückten Pfühle ihren zerbrechlichen und fast kindlichen Körper. Und wieder bedeckte er ihn mit beseligten Küssen, küßte jeden Muskel, jedes Haar, dabei die berauschenden Worte: du bist mein! du bist mein! wiederholend, und von neuem die ganze naive Ekstase ihrer nur unklar zum Durchbruch kommenden Sinnlichkeit mit ihr durchlebend.
Und gleichzeitig ließ er ein anderes Gesicht Lydias erscheinen, eines, wo sie im Augenblick der letzten Verzweiflung, verwundet von Eifersucht, nackt auf den schneebedeckten Hof herauslief, auf der Freitreppe hinstürzte, so daß aus ihrem zerschlagenen Kopfe das Blut strömte. Und wieder hob er sie auf seine Hände und trug sie ins Haus; zwei irrsinnige ungläubige Augen, die plötzlich förmlich nur aus der Iris bestanden, sahen ihn an. Sie war ganz wie ein vergiftetes Tierchen und in seiner Seele war nichts, außer dem unersättlichen Mitleid zur Geliebten, außer dem zärtlichen Hunger, ihr ein grenzenloses Glück zu geben und in ihm wie in den Strahlen der Sonne zu zerschmelzen.
Doch sei dies nicht Lydia, — o würde in seinen Händen der entblößte, völlig nackte Leib Maras zittern in einer jener heimlichen Zusammenkünfte, welche die beiden aus der Welt der Lebenden völlig hinausrissen und sie auf einen anderen und entfernten Planeten trugen. Und wieder ergriff ihn das Verlangen der Entrückung, das er immer noch so gut kannte, wenn er mit ihr war, das Verlangen nach etwas größerem als Küsse, als Zärtlichkeiten, als die leidenschaftliche Hingabe seiner selbst; das Verlangen, mit seinem ganzen Leben in sie einzudringen und wiederum ihr ganzes Wesen in sich aufzunehmen. In seinen Augen lagen so berückend die Linien ihres Leibes und das eigentümliche quälend-erwünschte Atmen dieses Leibes floß förmlich in seine Nasenflügel und Lippen wie ein scharf berauschendes Getränk.
Und wieder sind sie einander nah. Und wieder entsteht die Qual der sinnlichen Verzückung. Sie wächst, sie geht bis an alle Grenzen, sie verwandelt sich in Wut und Haß. Und da stoßen auch beide schon mit Abscheu einander von sich. Als ob sie erwacht wären, sehen sie sich voll Entsetzen an und jedem ist es unerträglich, mit dem andern zu sein. Einer erkennt im andern seinen ewigen, seinen vorher bestimmten Feind, und all die beleidigenden Worte der Schmähung, welche nur der Haß ihnen zuflüstern kann, kommen auf ihre Lippen. Sie schämen sich ihrer Nacktheit. Seine Blicke sind ihr eine Schmach, und erniedrigend scheint ihr seine Berührung. Und auch er will sich auf sie werfen, sie schlagen, töten, töten . . .
Doch dies ist schon nicht mehr Mara. Kett steht vor ihm, hoch, schlank, jungfräulich, unberührt. Sie kam zu ihm, wie sie so oft schon früher in dieses Kabinett kam, wenn alles im Hause schlief, um ihm noch einmal zu sagen, daß sie ihn liebt, nur ihn ersehnt, aber niemals sich ihm hingeben wird. Durch ihre Augen sieht er in ihre Seele. Und der frühere Glaube, daß mit ihr, nur mit ihr es ihm möglich wäre, den unsagbaren und unerforschten Segen zu erlangen, daß sie, nur sie alle die geheimsten Wünsche seines Wesens in ihrer dunklen Begeisterung errät, läßt ihn wieder sich ihr zuneigen, und wieder ihr die einzigen unwiederbringlichen Worte sagen. Und da neigen sich auch schon, als ob es wider ihrem Willen geschieht, ihre Gesichter einander zu und von neuem erstehen die alten wütenden Küsse, welche die Lippen blutig zerspringen lassen. Die Hände verschlingen sich in Umarmungen, die fast wie Schmerz sind, vereinigen sich wie Ringe; sie fallen auf den Fußboden und pressen ihre Kniee aneinander. Und wie Feinde in einem Walde, so kämpfen sie. Er bricht ihre Hände, und sie beißt ihn wie eine Katze. Das verhaltene Atmen geht zu Schreien über. Wie metallene Federn springen sie plötzlich jäh auf; sie mit zerrissenen Kleidern, er mit entblößter Brust. Er wirft sich in einen Sessel, sie verschwindet wie ein Schatten . . .
Gesichter der Wirklichkeit, Gesichter des Vergangenen kreisen wie Schneeflocken hinterm Fenster. Und abwechselnd beugen die drei Frauen über ihn ihre Gesichter, die bald glücklich sind, bald berauscht, bald von Verzweiflung verzerrt, bald wahnsinnig, bald beleidigend verächtlich. Er hört Worte der Liebkosungen und erbitterte Vorwürfe. Und er will, er will das alles: wie dies Glück, so auch diese Qual. Er dreht sich mit diesen Frauen in trunkenem Tanze, bald preßt er sich an ihre entblößten Brüste, bald verhüllt er die Augen vor ihren wilden Schlägen. Das Tempo des teuflischen Walzers wird immer rascher und schon ist er kraftlos, und schon ist er kraftlos, ihm zu folgen.
Ein Windstoß schlägt heftig ans Fenster. Nikolai erwacht auf einen Augenblick. Seine Hand fährt über die Stirn. Die Bilder waren so deutlich, daß er wie nach einer körperlichen Anstrengung in seinen Händen eine Schwäche fühlt. Oder sollte er sich auf dem Wege ernstlich erkältet haben? Er trinkt ein Glas starken Wein und Feuerströme fließen durch seine Adern.
Hinterm Fenster heult der Sturm seinen ungeheuerlichen Walzer. Und nichts ist dort zu sehen, außer dem Netz aus weißen Punkten.
Vor Nikolai stand Kett.
Lange schaute er sich in sie hinein und wußte nicht, ob dies wirklich Kett wäre oder nur eines seiner Traumgesichter. Endlich begann er zu glauben und reichte ihr seine Hände.
— Du? Du kamst? Ich erwartete dich. Nur dich.
Sie schüttelte verneinend den Kopf.
Er sank vor ihr auf die Knie. Er liebte es, vor ihr auf den Knien zu liegen und ihre langen schmalen Finger zu küssen. Er flehte:
— Küsse mich. O beug dich über mich.
Kett sah ihn mit ihren traurigen Augen an. Dann sprach sie:
— Ich kam, um mich von dir zu verabschieden. Ich darf nicht mehr mit dir sein. Ich ersehnte eine grenzenlose unendliche Liebe. In dir ist keine solche Liebe. Meine Liebe ist allzu groß für dich; und deine ist für mich — zu klein. Ach die Liebe ist tyrannisch! Sie verlangt, daß man sich ihr völlig hingebe. Nichts halbes nimmt sie entgegen. Du aber gabst unserer Liebe nur ein Drittel deiner Seele, ganz genau ein Drittel und förmlich wie auf der Wage abgewogen!
Er suchte sie zu besänftigen, indem er sein Gesicht an ihre Finger preßte.
— Kett! Kett! sprich nicht so zu mir. Sage mir nichts. Ich bin müde, ich bin kraftlos. Ich weiß ja selbst nichts. Laß mich mit dir sein, nur in deiner Nähe sein, nur fühlen, daß du meine Seele begreifst.
Sie befreite ihre Hände aus den seinen und entwand sich ihm.
— Deine Seele? Ja, ich begreife deine Seele! Habe sie zwei Jahre beobachtet. Sie hat von allem ein wenig nötig. Ein wenig meiner Liebe, ein wenig der Zärtlichkeit meiner einen Schwester, und ein wenig der Leidenschaft meiner anderen Schwester. O, wenn du doch nur einmal etwas ganz verlangen würdest! Wenn auch nicht mich, so doch etwas Ganzes, etwas bis zum Ende! Ach selbst, wenn du gewagt hättest, zu entfliehen! Doch du fuhrst bis zur Station und kehrtest zurück. Wie sieht das dir ähnlich!
Sie sprach hart und kalt. In ihrer Stimme waren Befehle des Höheren zum Niederen. Unendliche Trauer, unendliche Bitterkeit, unendliche Beleidigung erfüllten die Seele Nikolais. Und noch immer hielt er ihre Hände fest, obgleich er ihr rauh und mitleidlos antworten wollte.
— Wie aber, wenn du dich täuschest? fragte er sie. Wie, wenn ich zu lieben verstehe, wie du niemals geliebt hast? Mir genügt deine reine klare kristallene Seele nicht! Mir genügt dein geschlechtloses Gefühl nicht! Ich begehre auch nach jener Zärtlichkeit und jener Leidenschaft. Ihr selbst zerreißt meine einige, lebendige Liebe in drei Teile, und verwünscht dann die Kleinheit der blutenden Fetzen. Es ist an mir, eure Kleinlichkeit, eure Enge zu verachten. Ja, ich kehrte zurück, doch ich tat es, um zu sagen, daß ich nicht mehr euer Sklave bin, daß ihr mich nicht mehr beherrscht.
Hochmütig lächelnd entgegnete ihm Kett:
— Mir ist jetzt alles gleich. Ich verlange nichts mehr von dir. Ich träumte einmal davon, die ganze Fülle der Liebe zu erblicken. Ich hatte den sinnlosen Traum, die Liebe über alles siegen zu sehen, — über Leidenschaft, Mitleid, über das Bedingte. Doch du wagtest es nicht, deine Liebe mir hinzugeben, weil es dir furchtbar war, deine Frau zu betrügen: sie würde vielleicht vor Schmerz sterben! Du wagtest es nicht, deine Liebe mir hinzugeben, weil es dir schwer wurde, dich von den Küssen meiner anderen Schwester zu trennen! Und ferner, — dich hinderten die verschiedenen Bedingungen des Lebens! Und so entbinde ich dich von allen Schwüren, die du an mich verschwendet hast. Wenn ich mein Wesen nicht jener Liebe, die ich suchte, hingeben konnte, so werde ich es dem Tode geben, den ich will. Leb wohl!
Die Worte Ketts verwundeten Nikolais Seele wie kleine Pfeile. Schon lag er nicht mehr vor Kett auf den Knien. Zwischen ihnen war der Tisch. Seine Hände fest an seine Brust drückend, bemühte sich Nikolai gleichfalls hart und kalt zu sprechen:
— Warum heuchelst du? Glaubst du, ich hätte nicht schon lange den wirklichen Sinn deiner großen Worte erraten? Du willst einfach deine Mädchenunschuld bewahren. Du fürchtest die Sünde, dich dem Manne deiner Schwester hinzugeben. Du hütest deine erste Nacht für deinen gesetzlichen Ehegatten.
Da bog sich Kett über den Tisch, näherte ihr Gesicht dem Nikolais, so daß er in ihrer Iris sein Bild sah. Und dieses Mal waren in ihrer Stimme Wut und Spott:
— Glaubtest du denn, daß ich dich liebe? Glaube es nicht: ich experimentierte nur! Ich wollte nur in deiner Seele die Flamme der wahren, alles verzehrenden Liebe sehen. Nun ja! der Versuch ist nicht geglückt! Ich habe mich umsonst gezwungen, deine Küsse zu ertragen. Ich habe umsonst das Zittern des Abscheus bekämpft, wenn ich dir erlaubte, mich zu umarmen. Deine Seele war noch kleiner und enger als selbst ich es erwartete. Triumphiere, — du hast mich betrogen, da du dich größer und würdiger anstelltest, als du tatsächlich warst.
Sie begann zu lachen.
So standen sie im Triebe gegenseitigen Hasses einander aufs neue wie schon viele Male im Leben gegenüber und schleuderten sich Beleidigungen zu. Vor Nikolais Augen war es wie ein Nebel, und Ketts Bildnis verschwand bald, um dann aufs neue zu erstehen. Und schon wußte er nicht, ob sie zu ihm die wütenden Flüche sprach, oder ob er sie für Kett sich selbst sagte.
Wie Gewitterschein fiel plötzlich ein seltsamer Gedanke in die Weiten der Erkenntnis Nikolais. Scheu und ungläubig streckte er seine Hand aus und berührte ihre Hände.
— Kett! Kett! Bist du dies? fragte er. Oder bist du eine Erscheinung? Es ist ja nicht möglich, daß du mir das alles sagen kannst. Es sind doch dieselben Gedanken, die ich heute auf dem Wege durch die Schneefelder dachte? Du konntest ja nichts von dem wissen? Antworte mir!
Und sehr unerwartet, mit sehr verändertem Gesicht, mit unendlicher Zärtlichkeit, mit der letzten Liebkosung antwortete Kett:
— O, natürlich, natürlich, ist das alles Lüge! Es ist nur das eine wahr, daß ich dich liebe, doch ich darf nicht mit dir sein. Und so kam ich her, dir meine Liebe beweisen.
Nikolai erblickte in Ketts Hand einen Dolch. Sie führte die Schneide an ihre Lippen und küßte sie. Dann öffnete sie das Kleid. Langsam stieß sie den Dolch dort hinein, wo ihr Herz schlagen mußte. So stand sie noch einige Augenblicke, bleich und mit geöffneten Lippen. Dann fiel sie hin.
Und sofort verließ Nikolai jene Erstarrung, die sich immer im Traum einstellt, wenn man fliehen muß. Er warf sich auf Kett, um sie aufzuheben, seine Lippen auf ihre Wunden zu drücken, ihr zu sagen, daß er nur sie liebe — und erwachte.
Er war allein in seinem Kabinett, und saß auf seinem Sessel. Unter dem grünmetallenen Schirm brannte die Lampe hell und gleichmäßig. Ringsum war es still.
War es denn Kett, die zu ihm hereinkam? Oder war alles nur ein Fiebertraum?
Er trank noch mehr Wein. In den Schläfen hämmerte es.
Lange saß Nikolai so, seinen Kopf in seine Hände gepreßt. Um seine Erregung zu bekämpfen, bemühte er sich, etwas Nebensächliches, Unwichtiges zu denken. „Dann, dann,“ sprach er zu sich, „dann will ich alle Fragen entscheiden, aber jetzt muß ich mich beruhigen, sonst werde ich verrückt.“ Doch es waren immer dieselben Gedanken, immer dieselben Bilder, die zu ihm kamen, wie Wellen in der Stunde der Flut zu dem ausgehöhlten Stein kommen.
Es ist sehr schwer, so allein zu sein mit den Gedanken, wenn sie plötzlich ein unabhängiges Leben gewinnen, unerbittlich einen bestürmen und die geschwächte Erkenntnis mit langen Speeren besiegen! Könnte man weggehen aus diesem einsamen Zimmer, das allen Traumgesichtern offen steht, — zum Licht, zum Menschenwort, zu den Menschen! Ist denn wirklich der schweigende Ruf der Seele zu schwach, um jemand hereinzurufen, der mitleidig wäre und trösten könnte? Er hat keine Kraft mehr, er bittet um Erbarmen.
Und leise und kaum hörbar öffnete sich die Türe. Mit den zärtlichen Schritten des liebenden Weibes kam Lydia herein, trat an ihn heran, legte ihre Hände auf seine Schultern:
— Du bist müde, Nikolai, bist krank, leg dich zu Bett.
Fieberhaft grub er sich in ihre Hände. Er wandte ihr sein erhitztes Gesicht zu. In der Welt quälender Halluzinationen, wie war es freudig, ein schlichtes und mildes Gesicht zu sehen! Und war nicht ein leichtes Scheinen um diesen Kopf wie bei den Heiligen der raphaelitischen Bilder?
Er lehnte seine Wange an Lydias Hand und gehorsam sagte er:
— Ja Lydia, ich bin krank, bin müde, sehr müde. Doch nicht vom heutigen Tage, aber vom ganzen Leben. Ja, nimm mich, ja, führe mich fort. Doch nicht nur aus diesem Zimmer, aber aus den Qualen meines Lebens. Ich ziehe mich zurück. Ich erkläre mich für besiegt. Rette mich, da du allein mich retten kannst.
Ihre Augen füllten sich leise mit Tränen. Kraftlos sank sie zu seinen Füßen nieder, bettete ihren Kopf auf seine Knie, flüsterte ihm zu:
— Jetzt bittest du mich um Hilfe. Aber dachtest du an mich in jenen Monaten, wo ich tags und nachts mit dem Kopf an die Wände schlug, wo ich stundenlang auf dem Fußboden lag, im Verlangen, tiefer zu fallen, noch tiefer. Wenn es dir in den Kopf kam, mich zu liebkosen, dachtest du daran, daß ich vor Trauer fast verrückt wurde? Aber du verlangtest, daß ich lächeln sollte; du fragtest, ob ich nicht glücklich wäre und warum ich mich nicht freue, daß ich mit dir sei? Gehorchend wurde ich fast zu einem Automaten. Ich lernte lachen, wenn du mein Lachen wolltest, lernte Worte sprechen, die du mir vorsagtest. Alles, was in mir mein war, mein Eigenstes, rissest du heraus. Du hast meine Seele verwüstet, was erwartest du jetzt noch von mir?
Wie in einem Anfall plötzlichen Schmerzes preßte Nikolai ihre Hände. Antwortete voller Trauer:
— Ich werde nicht lügen. Ich habe dir nichts zu geben und will dir alles nehmen. Ich bitte dich um ein Opfer, eine Tat. Ich werde niemals aufhören, jene, die anderen, zu lieben. Und zuweilen werde ich dich darum hassen, weil du nicht sie bist und nicht ihre Worte und Liebkosungen kennst. Doch du zeige mir die ganze Grenzenlosigkeit der Liebe. Sei mein Schicksal, meine Gnade, mein Segen. Sei mir eine Mutter. Sei mir eine ältere Schwester. Wiege mich ein mit zärtlichen Händen. Streichle mit ihnen mein Herz, — es hat so nötig die Berührung zarter Finger.
Ihr Atem ging unmerklich in Schluchzen über. Sie zitterte auf seinen Knien, die Kleine, die Hilflose.
— Zu spät! sprach sie durch Tränen. Monate und Monate hindurch erwartete ich diese Worte. Mit letzter Anstrengung hielt ich in mir die versiegenden Quellen der Liebe und Verzeihung zurück. Ich sagte mir: er wird zu mir kommen, ein Unglücklicher, Zerquälter und ich werde alles vergessen und ihm alles sein, was er nur verlangt. Doch du kamst zu mir mit Lippen, die noch heiß waren von anderen Küssen, suchtest in mir nur ein anderes, als in den anderen, verlangtest, daß ich in deinem Leben eine Dekoration wäre. Und vergebens sprach ich noch zu mir: das wird morgen sein . . . Aber ich weiß selbst nicht, es flossen unbemerkt die letzten Tropfen aus mir, es verwehte der letzte Rausch. Ich bin eine Wüste. Ich bin nur ein Schatten. Was könnte ich dir geben?
Nikolai beugte sich zu ihrem Ohr, lehnte ihren so bekannten ihm verwandten Körper an seinen und, indem er sich bemühte, seiner Stimme all die Töne früherer Tage zu geben, flüsterte er ihr zu:
— Lydia! Im Namen unseres gestorbenen Sohnes . . . im Namen unseres künftigen Kindes.
Sie befreite sich aus seinen Händen. Ihr von Tränen gerötetes, ihr seltsam zerdrücktes Gesicht mit den auf die Stirn hinunterfallenden Haaren, war furchtbar und erbarmenswert und wieder wurden die Augen wahnsinnig und groß.
— Unseres Sohnes? fragte sie zurück. Hast du es denn noch nicht begriffen, daß ich selbst ihn getötet habe? Hast du nicht begriffen, warum ich an seinem Sarge nicht weinen konnte? Aber ich weinte, habe zuviel um ihn geweint, als er noch lebendig war. Doch ich war das Werkzeug Gottes, der mir, der Mutter, befahl, dich in deinem Sohne zu treffen. Ich nahm ihn aus seinem Bettchen, ich legte ihn auf ein Kissen und während ich weinte und seinen Körper küßte, erwürgten ihn meine Hände. Und als er aufgehört hatte zu atmen, da ging ich, dich und deine Geliebten rufen und den Doktor und alle! Und ihr begrifft es nicht, niemand, niemand!
Sie lachte mit dem furchtbaren Jubel des hysterischen Lachens. Nikolais Gedanken verwirrten sich. Er wußte, er fühlte, daß sie die Unwahrheit sprach. Doch es fehlte ihm an Kraft, zu entdecken, worin die Unwahrheit wäre. Er fand keine Worte, und wiederholte nur stumm:
— Es ist Lüge, es ist Lüge.
Ohne Kraft zu sprechen, zeigte sie mit der Hand zur Seite. Dort, auf dem Sessel, auf dem weißen verhüllten Kissen lag mit purpurnem Gesicht und hervorgequollenen Augen der Leichnam seines Kindes.
„Wie aber hat der Doktor denn nicht begriffen, daß es erwürgt sei?“ dachte Nikolai.
Dann aber begriff er diesen Gedanken und schrie sich selbst zu:
— Welcher Irrsinn! Mein Sohn ist vor einigen Wochen gestorben und längst begraben. Dies ist wieder ein Fiebergesicht.
Er glaubte zu ersticken und versuchte angestrengt, zu erwachen. Aber das Zimmer begann sich mit kleinen nackten Körpern gestorbener Kinder zu füllen, mit diesen blutlosen, verkrümmten, abscheulichen. Das war eine ungeheuere Morgue, in welcher er der Mörder aller war, schuld an jedem Tode. Und sein Kopf drehte sich und alles begann, sich ringsum zu drehen, und ein wildes Geheul erfüllte seine Ohren, als würden Teufel um ihn kreisen.
Mit letzter Willenskraft entriß er sich diesem Alpdrücken und kehrte zur Wirklichkeit zurück.
Rings war alles wie immer still. Wie früher saß er an seinem Schreibtisch.
Er fühlte große Hitze. Er hatte Fieber. Man müßte weggehen von hier, sich ins Bett legen. Doch es fehlte an Kraft. Er fühlte, daß die Klarheit nur einen Augenblick dauern würde, daß das Fieber sofort aufs neue beginnen müsse.
Einige Zeit kämpfte Nikolai noch auf der Grenze des Realen, wehrte sich gegen den Schritt in die Welt der Gespenster und des Entsetzens. Doch irgend eine Kraft besiegte ihn und wie in eine Schlucht, so stürzte er wieder in den Abgrund seiner Gesichter.
Die Türe bewegte sich zum dritten Male.
„Jetzt werde ich Mara sehen“, dachte Nikolai.
Mara kam herein.
Ihre Lippen waren aufeinandergepreßt. Ihre Augen schauten konzentriert. Sie sagte:
— Ich kam, um dich zu holen.
Und schon fehlten ihm Kraft und Willensstärke, um zu kämpfen. Mit einem Zeichen hieß sie ihn aufstehen und gehen. Wie ein Mondsüchtiger folgte er ihr durch die dunklen Zimmer und dachte daran, wie der Fieberwahn das Aussehen aller Gegenstände verändere.
Im Gastzimmer brannten die Kerzen hell in ihren Kandelabern.
— Sieh hin, sagte Mara.
Auf dem Divan lagen zwei Körper. Es waren Lydia und Kett. Beide waren tot. Auf dem Boden lag in dunkelroten Flecken das Blut, und färbte in ungeheueren Kreisen den Stoff des Divans. Blutgeruch erfüllte das ganze Zimmer.
Im Kopf Nikolais verwirrten sich die Bilder und Gedanken. Sein ganzer Körper zitterte. Um nicht zu fallen, stützte er sich auf die Lehne eines Sessels. Zuweilen glaubte er an die Realität all dessen, was er sah, zuweilen erkannte er, daß es nur ein Fieberwahn sei. Bald wollte er erwachen, bald seinen Wahnsinn fortsetzen.
Mara sagte ihm etwas, und es war gewaltig und voller Befehle. So wird man vielleicht auf dem Letzten Gerichte sprechen. Langsam begann Nikolai zu hören und den Sinn ihrer Worte zu verstehen.
— Darum tötete ich sie, sagte Mara, weil du sie liebtest. Diese Stunde war ihre letzte Stunde und ich konnte sie schon nicht mehr vorübergehen lassen. Sie würde sich nicht wiederholt haben. Ich willigte ein, das Schicksal zu spielen. Das Schicksal muß wohl schön sein. Und nur jene Liebe ist wirklich schön, die vom Tode gekrönt wird. Unser Zweikampf ist der ewige Zweikampf des Mannes und der Frau. Du hättest wohl gewünscht, daß alle Frauen der ganzen Welt dir gehören sollen; ich aber wäre bereit, die ganze Welt zu verwüsten, um mit dir allein zu sein. Lange warst du der Sieger, doch der letzte Kranz ist mein! Vielleicht wurde mein Sieg nur durch Untreue erkämpft, aber die Liebe rechtfertigt alles und auch die Untreue! Unsere Welt ist verwüstet, da wir nur noch einige Stunden zu leben haben und in diesen Stunden werden wir allein sein!
Noch immer konnte Nikolai kein Wort sprechen. Manchmal glaubte er, den Verstand zu verlieren. Mara dachte, daß er schwankend geworden wäre und sprach ihm mit weißem und verzerrtem Gesichte von etwas anderem. Daß sie alles vorhergesehen hätte. Daß es nutzlos wäre, jemand zu rufen. Daß man ihn in jedem Falle der Mitschuld am Verbrechen bezichtigen würde, ihn richten, verurteilen . . .
Die letzten Worte machten Nikolai fast lächeln. So lächerlich erschien ihm der Gedanke, daß der nächste Tag in irgend einer Verbindung mit dieser wahnsinnigen Nacht sein könnte.
Seltsam kam es Nikolai vor, daß er nicht bemerkt hatte, wann Mara die Kleider auszog. Und in dem Zimmer des Todes stand sie vor ihm so sehr nackt, wie sie es liebte, sich ihm hinzugeben. Durch den erstickenden Blutgeruch drang der bekannte und so einzige Duft ihres Körpers bis zu ihm.
Und Mara rief ihn, zärtlich und liebkosend.
— Liebster, komm her, komm. Ich will, daß du mich liebkosen sollst. Ich will dich. Will, daß wir im selben Augenblicke dasselbe fühlen sollen. Und dann wollen wir beide sterben und auch im selben Augenblick. Und der Tod wird uns sein, wie eine Zärtlichkeit.
Doch erst, als Mara ihm schon ganz nah war und sich an ihn schmiegte und ihm in die Augen schaute, konnte Nikolai erwidern:
— Ich weiß, daß du ein Schatten bist, ein Traumgesicht, nur eine Erscheinung Maras. Doch der Erscheinung kann und will ich alles sagen, was ich ihr nicht gesagt. Ich glaube, daß aus all den Gefühlen, die mich peinigten und betörten, nur jenes heilig war, das ich ihr entgegenbrachte, deinem Urbilde! Weil unsere Liebe der Ruf des Körpers zum Körper war, und ganz ein sinnliches Verlangen, das noch nicht von Freundschaft oder Mütterlichkeit befleckt war. Unsere Liebe war das auf allen Welten gleiche elementare Geheimnis, das den Menschen ähnlich macht den Dämonen und Engeln.
Nikolai konnte selbst nicht begreifen, warum er von seiner Liebe als von etwas Vergangenem sprach.
Dann ließen sich die zwei langsam auf einen Teppich sinken und preßten sich in Umarmungen aneinander. Die Wirklichkeit begann zu schmelzen und zu verschwinden und zur Unendlichkeit wurde jener kleine Raum, in dem sich die beiden Körper befanden. Der Augenblick jenes Rausches trat ein, wo der Mensch sich als einen Vogel fühlt, der über dem Abgrund hängt, und wo er immer grade vor sich die anderen Augen sieht, die beschattet sind von der Qual entrückter Sinnlichkeit, und wo er kreist und kreist und plötzlich loslassend wie ein Pfeil hinunterschießt in die Gischt der Abgründe.
Als er erwachte, sah Nikolai die beiden toten Körper, die noch immer so unbeweglich auf dem Divan ausgestreckt lagen. Lydias Gesicht war milde und ihre klagenden geöffneten Lippen fragten: schon? — aber das stolze und ruhige Gesicht Ketts antwortete: mag sein! Als Nikolai sich den Körpern nähern wollte, hielt Mara ihn zurück:
— Nicht nötig, nicht nötig.
Es war Wein da. Sie tranken ihn. Sie sogen den Duft aus Blut, Wein und Leidenschaft ein. Sie bemühten sich, nur einander in die Augen zu schauen. Ihre Gesichter brannten, und in ihren Augensternen spiegelten sich die brennenden Kerzen wie Funken.
Die Stunden vergingen. Und es waren Ekstasen der Leidenschaft und Ekstasen der Ermattung. Und es war die Seligkeit der Bekenntnisse und die Seligkeit des Schweigens. Ihre Körper waren von Umarmungen geschwächt und konnten dennoch nicht den Liebkosungen entsagen. Ihre Seelen, die sich einstmals dem Leben wie blühende Blumen geöffnet hatten, errieten hinter jedem gesagten Worte die ganze Unendlichkeit seiner Bedeutung. Dann aber verschmolz sie das schon nicht mehr zu befriedigende Verlangen wieder und wieder in eines und sie taumelten auf dem harten Fußboden, der kaum vom Teppich bedeckt war, inmitten der Flecken von Blut.
Draußen begann es, trotz des wütenden Sturmes allmählich heller zu werden. Bleiche Lichtflächen legten sich auf die Wände, die Möbel, die Teppiche. Langsam veränderte sich die Welt.
Drei Tage lang beschäftigten sich die örtlichen Zeitungen mit den ungeheuerlichen Vorkommnissen auf dem Gehöfte des Nikolai S. Die vier Leichname konnten niemand von den Geheimnissen der furchtbaren Nacht erzählen. Die Dienerschaft wurde anfangs arretiert, doch bald infolge mangelnder Beweise wieder freigelassen. Das Geschehnis blieb ein unaufgeklärter Fall. Die Nachricht von dem geheimnisvollen Morde oder Selbstmorde der drei Schwestern und des Mannes einer derselben drang nur in Form von kurzen Bemerkungen in die größeren Blätter und erschien dort in kleiner Schrift auf der vierten Seite in der „Provinzialchronik“. Übrigens konnten sich die Leser dieses intimen Familiendramas im Lärme der großen politischen Ereignisse jenes Jahres dafür auch nicht interessieren.
Nach einer italienischen Handschrift des 16. Jahrhunderts
 Sultan Mahomed II., der Eroberer, welcher zwei
Kaiserreiche sich unterworfen hatte, vierzehn Königreiche
und zweihundert Städte, schwor, daß er
sein Roß mit Hafer vom Altar des heiligen Petrus
in Rom füttern wollte. Achmed Pascha, der Großvezier
des Sultans, durchschiffte mit einem ungeheuren
Heere die Bucht, umlagerte Otranto zu Wasser und
zu Lande und nahm es im Sturmangriff vom 26. Juni im
Jahre des Heils 1480. Die Sieger kannten ihren Greueln
keinen Einhalt: Messer Francesko Largo, den Befehlshaber
des Heeres, zerschnitten sie mit einer Säge, viele der noch
kampffähigen Einwohner wurden umgebracht, der Erzbischof,
die Priester und die Mönche wurden in ihren Kirchen
auf alle mögliche Weise beleidigt, die wohledlen Damen und
Jungfrauen durch Vergewaltigung geschändet.
Sultan Mahomed II., der Eroberer, welcher zwei
Kaiserreiche sich unterworfen hatte, vierzehn Königreiche
und zweihundert Städte, schwor, daß er
sein Roß mit Hafer vom Altar des heiligen Petrus
in Rom füttern wollte. Achmed Pascha, der Großvezier
des Sultans, durchschiffte mit einem ungeheuren
Heere die Bucht, umlagerte Otranto zu Wasser und
zu Lande und nahm es im Sturmangriff vom 26. Juni im
Jahre des Heils 1480. Die Sieger kannten ihren Greueln
keinen Einhalt: Messer Francesko Largo, den Befehlshaber
des Heeres, zerschnitten sie mit einer Säge, viele der noch
kampffähigen Einwohner wurden umgebracht, der Erzbischof,
die Priester und die Mönche wurden in ihren Kirchen
auf alle mögliche Weise beleidigt, die wohledlen Damen und
Jungfrauen durch Vergewaltigung geschändet.
Des Francesko Largo Tochter, die schöne Julia, begehrte der Großvezier selbst in seinen Harem. Doch die stolze Neapolitanerin willigte nicht ein, Maitresse des Ungläubigen zu werden. Sie empfing den Türken bei seinem Besuche mit solchen Schmähungen, daß ihn ein furchtbarer Zorn gegen sie befiel. Natürlich hätte Achmed Pascha den Widerstand des schwachen Mädchens mit roher Gewalt besiegen können, doch er beschloß, sich grausamer zu rächen und ließ sie in den städtischen unterirdischen Kerker werfen. In diesen Kerker warfen die neapolitanischen Herrscher nur unverbesserliche Mörder und schwärzeste Bösewichte, deren Strafe schlimmer sein sollte als der Tod.
Julia, die man an Händen und Füßen durch dicke Stricke gefesselt hatte, wurde in einer verhüllten Sänfte zum Kerker getragen, da selbst die Türken ihr eine gewisse Ehrerbietung die ihr nach Geburt und Stellung zukam, nicht verweigern konnten. Auf enger und schmutziger Treppe wurde sie in die Kerkertiefe hinabgezerrt und mit einer eisernen Kette an die Wand geschmiedet. Julia hatte nur ihr prächtiges Gewand aus Lyoner Seide an, alle ihre Schmucksachen hatte man ihr fortgenommen: goldene Ringe und Armbänder, ihr Perlendiadem und die diamantenen Ohrringe. Jemand zog ihr sogar die Safianstiefelchen, die aus dem Orient stammten, ab, so daß Julia barfuß blieb.
Der Kerker war eine Erdhöhle unter dem Turme der Stadtmauer. Zwei mit dicken Eisenstäben fest vergitterte und dicht an der Decke belegene winzige Fenster reichten nur mit ihren oberen Teilen ans Tageslicht. Sie ließen nur ein wenig Helligkeit durch, damit im Kerker kein ewiges Dunkel wäre, und damit die an das Halbdunkel gewöhnten Augen die Mitgefangenen unterscheiden könnten. In den Steinmauern waren starke Haken mit Ketten und Eisengürteln angebracht. Diese Gürtel wurden fest um die Eingesperrten geschlungen und dann verschlossen.
Sechs Gefangene waren im Kerker. Die Türken wollten keinen von ihnen befreien, da sie die Gebräuche der Länder, die sie erobert, fortzuführen liebten. Und Julia ward angekettet neben der alten Vanozza, die wegen Zauberei und Verkehr mit dem Teufel verurteilt worden war, und neben dem bleichen Jüngling Marco, der schon während der Belagerung hier eingesperrt wurde, da er an einer Verschwörung gegen den Befehlshaber der Stadt teilgenommen hatte.
Julia lag in den ersten Stunden ihrer Gefangenschaft wie eine Tote. Sie war von all dem mit ihr Geschehenen erschüttert und glaubte in der dumpfen und übelriechenden Kerkerluft ersticken zu müssen. Von Minute zu Minute erwartete sie ihr Hinscheiden.
Die andern Gefangenen, die noch nichts von der Einnahme der Stadt wußten, besprachen unterdes, was sie gesehen. Anfangs stritten sie lange über den Grund des Erscheinens der Türken in ihrem Loche. Dann sprach man von Julia, kritisierte ihr Äußeres, ihr Gesicht, ihre Kleidung und warf die Frage auf, wer sie sei und was sie wohl in diese Höhle gebracht hätte.
— Ein schönes Mädchen, sagte Lorenzo, der alte Räuber, der an dem der Julia entgegengesetzten Ende des Kerkers angekettet war, — schade nur, daß ich so weit von ihr bin. Du aber, Marco, säume nicht!
— Das ist ein wichtiger Vogel, ist nicht für uns, sagte die alte Vanozza, — und was trägt sie für ein Kleid! Einen ganzen Dukaten ist die Elle wert.
— Daß ich den Kopf ihr zerschlüge, wär sie mir nur näher, sagte Cosimo aus seiner dunklen Ecke heraus, — sie ist von jenen, die in Seide gehen, während wir hungern.
Die leidende Maria, die schon längst fast zum Skelett geworden, und die der frühere Kerkermeister jeden Tag fragte, ob sie nicht bald stürbe, bemitleidete Julien:
— O, schwer wird es ihr werden, so vom weichem Pfühle auf die nackte Erde zu kommen, vom fürstlichen Mahle zu Wasser und Brot!
Aber der Prophet Filippo, der entsprungene Mönch, der im Kerker schon über zwanzig Jahre saß, und ganz mit Haaren bewachsen war, drohte mit schrecklicher Stimme:
— Nah ist die Zeit, sie ist nah. Die Welt ist den Ungläubigen übergeben, zur Züchtigung der Stolzen und Schlemmenden, damit später die Kleinen und Armen sich freuen können. Freut euch.
Und nur Marco schwieg. Übrigens betrachteten ihn die Gefangenen noch nicht völlig als den ihrigen, da er ein Neuhinzugekommener war.
Langsam kam Julia zu sich. Doch ihre Augen blieben geschlossen und sie bewegte sich nicht. Sie hörte von sich sprechen, aber begriff kaum ein Wort. Dann dunkelte es immer mehr und die Gefangenen schliefen einer nach dem andern ein. Von allen Seiten scholl lautes Schnarchen. Da erst konnte Julia weinen und sie schluchzte bis zum ersten Lichte.
Früh am Morgen stiegen die neuen Kerkermeister zu ihnen herab. Das waren zwei Türken: der eigentliche Kerkermeister war älter, sein Gehilfe jünger. Sie begannen, wie das auch ihre Vorgänger taten, den Kerker zu reinigen. Der Gehilfe nahm mit einer Schaufel den Unrat, der sich tagsüber ansammelte, weg, während der andere den Gefangenen Stücke verschimmelten Brotes zuteilte und in ihre Lehmkrüge Wasser goß.
Anfangs wagten die Gefangenen nicht zu sprechen, aber dann erkühnten sie sich, zu fragen, was denn eigentlich geschehen sei, und warum man sie nicht freiließe, wenn doch die Stadt von anderen beherrscht würde. Doch die Türken verstanden kein Italienisch.
Den altern Kerkermeister reizte Julias Schönheit und Jugend. Er legte seinen Brotsack beiseite, sagte ihr einiges in schmeichelndem Tone und wollte sie umfangen. Doch Julia, die ihre traurige Lage vergaß, wollte keine solche Beleidigung ertragen und schlug ihn ins Gesicht.
Der Türke wurde wütend, ergriff eine Peitsche, die er zufällig bei sich trug, und begann, sie grausam zu peitschen. Alsdann, akkompagniert vom Lachen und fröhlichen Schreien des ganzen Gefängnisses, vergewaltigte er sie.
So gewann die Jungfernschaft der schönen Julia Largo, die ihre Gunst selbst dem Großvezir des Sultans versagt hatte, ein einfacher Türke, dem es nicht einmal gegeben war, die Frauen aus dem Harem seines Paschas jemals sehen zu können.
So vergingen die Tage im Kerker.
Julia gewöhnte sich allmählich an ihre furchtbare Umgebung, an die verpestete Luft, an das steinharte Brot und an das faulende Wasser. Sie gewöhnte sich selbst an Dinge, an die sie früher ohne die äußerste Scham nicht einmal denken konnte. Schweigend nahm sie des Kerkermeisters Liebkosungen täglich hin, sowie auch zuweilen seine Schläge. Sie entschloß sich, wie alle Gefangenen es taten, vor aller Augen das zu tun, was die Leute gewöhnlich verbergen.
Die Gefangenen waren in solchen Abständen angekettet, daß der eine sich nur mit Mühe bis zum andern strecken konnte. Die Länge der Kette erlaubte ihnen zu sitzen, doch schon zu stehen war unmöglich. Doch ungeachtet dessen erdachten die Gefangenen sich eine ganze Reihe von Zerstreuungen. Lorenzo und Cosimo stellten sich Würfel her und würfelten ganze Tage — um Brot und Wasser; zuweilen mußte der Verlierende ganze fünf Tage hungern. Sehr oft nahm auch die Vanozza an ihrem Spiele teil. Cosimo belustigte sich außerdem damit, auf die anderen Gefangenen mit Steinen und Erde zu werfen. Dadurch brachte er dann den Filippo so in Wut, daß der wie ein Stier zu brüllen begann und an den Ketten riß, daß die Wände nur so zitterten. Sonst war Filippo eifrig damit beschäftigt, eine Kreuzigung Christi in die Wand neben sich zu meißeln. Zuweilen auch erhoben sich unter den Gefangenen lange Gespräche, die immer in ein wüstes Geschimpfe übergingen. Zuweilen aber gingen ganze Tage vorbei, an denen keiner sprechen wollte: alle lagen in ihren Winkeln, voll Wut und Verzweiflung.
Inmitten der Gefangenen blieb Julia einsam. Sie antwortete auf keine Frage, und es war, als hörte sie die Schmähungen nicht, mit denen sie überschüttet wurde. Sie sagte keinem, wer sie sei, und dies blieb ein Geheimnis für alle Insassen des Kerkers. Sie verbrachte die Tage in schweigsamem Nachsinnen, ohne zu weinen, ohne zu klagen.
Nur mit ihrer Nachbarin, der alten Vanozza, tauschte sie zuweilen einige Worte aus. Vanozza, die im Kerker schon viele Jahre saß, gab Julien mehrere wichtige Ratschläge. Unterwies sie, von Zeit zu Zeit auf den Zehenspitzen zu sitzen, damit die Füße nicht steif würden. Zeigte ihr, wie man es anstellen müsse, damit der eiserne Gürtel nicht allzu sehr den Körper presse. Riet ihr, jeden Morgen den im Kruge gebliebenen Wasserrest auszusprengen, damit das Wasser nicht verfaule. Julia mußte die Nützlichkeit dieser Ratschläge einsehen und antwortete aus Dankbarkeit auf die Stimme der Vanozza.
Einmal stieß Julia unversehens an ihren Krug und vergoß ihr Wasser. Die Gefangenen hüteten ihr Wasser sehr, denn es war Sommer und im Kerker sehr heiß. Furchtbar quälte Julia der Durst, aber sie zeigte es nicht.
Der neben ihr angekettete Marco rückte ihr seinen Krug heran.
— Du willst trinken, sagte er, — und ich bitte dich, nimm mein Wasser.
Julia sah den Marco an. Seine schwarzen Augen kamen ihr schön vor und ebenso seine bleichen Wangen.
Sie sagte:
— Ich danke dir.
An diesem Tage war das schlechte Wasser ganz besonders erfrischend.
Seit diesem Tage begann Julia mit dem Marco zu sprechen. Anfangs waren ihre Gespräche sehr abgerissen. Aber allmählich begannen sie mehr und mehr miteinander zu reden. Und zuletzt verbrachten sie ganze Tage in Unterhaltungen.
Julia erzählte von der Pracht und dem geselligen Leben in den Palästen: von den gewölbten Galerien und dem Fußboden aus Mosaik, von Möbeln aus kostbarem Holze und Lüstern aus venezianischen Glase, von Gärten mit künstlichen Wasserfällen und Fontänen, von Kleidern, die mit Gold und Perlen ausgenäht sind, vom Fest und vom prunkenden Mahl, von Bällen mit Tanz, Maskeraden in den von Lampions geschmückten Gärten, von Illuminationen und von den heiteren Jagden im Walde; von Theateraufführungen und vom Spiel auf dem Spinett, der Zither, Flöte und dem Klaviere; erzählte von den Werken der Kunst, von Spangen, Braceletten, Diademen, welche die besten Juweliere gearbeitet hatten, von feinen artigen Medaillen, von Statuen der alten und neuen Bildhauer, von wundervollen Bildern der großen neuen Maler, die Geschehnisse aus der heiligen Geschichte, Szenen aus den römischen Göttersagen oder Bilder des gegenwärtigen Lebens darstellten; erzählte alles, was sie in den Büchern des Filelfo, Pontano, Panoramito, Alberti und anderer zeitgenössischer Schriftsteller gelesen hatte; wiederholte die Novellen des Poggio und Boccaccio und deklamierte die Verse des Petrarca.
Marco hingegen sprach von den schönen Muscheln, die er im Meere gesammelt, von den wunderlichen und bunten Fischen, die er in seinen Netzen gefangen, von den Krabben, deren Gang seitwärts ist, und von den unförmlichen Tritonen; gedachte der nächtlichen Fischfänge, beim Schein der Pechfackeln, der Wettfahrten in Boten, der tiefblauen Grotten, der furchtbaren Stürme auf dem Meere; beschrieb das Leben in Sizilien und Afrika, in den Ländern, wo schwarzhäutige Menschen, Elefanten und Kamele leben; gab wieder die Erzählungen von den Irrfahrten Sindbads des Seefahrers, der einst den Rücken eines Meeresungeheuers für ein Eiland angesehen hätte, der in den Ländern war, wo Menschen ohne Köpfe leben, der den Vogel Rochen weit hinter den Mondbergen gejagt hatte; er träumte von den Sirenen des Meeres, die des Nachts auf Leiern mit goldenen Saiten spielen und die jungen Fischer zu sich heranlocken, um sie zu ertränken, träumte von den Salamandern, die unsichtbar in der Luft rings um uns leben, und die nur im Feuer sichtbar sind, weil sie durch dieses hindurchgehend, entflammen müssen, träumte von den schwarzen Titanen, die unter dem Vesuv liegen und deren Atem schwarzer Rauch ist, und auch von dem Leben auf der Sonne und den Sternen und von den singenden Blüten und von den Mädchen mit Flügeln, ganz wie Schmetterlinge.
Nur von einem sprachen Julia und Marco nie: von ihrem Gegenwärtigen und Zukünftigen, von dem, wie die Tage im Kerker wären, und was sie erwartete.
Die anderen Gefangenen lachten anfangs über ihre Gespräche, hörten aber bald auf, ihnen irgend welche Aufmerksamkeit zu schenken.
Da sie einander erkannten, schämten sich Julia und Marco wieder vor einander. Und wieder begannen sie jenes im geheimen zu tun, was die Leute vor fremden Augen verbergen.
Eines Morgens wandte der Kerkermeister Julien seine Aufmerksamkeit wieder zu, obgleich sie, geschwächt durch Hunger, Luftmangel und Krankheit, nicht mehr zu den ausnehmenden Schönheiten gerechnet werden konnte. Der Türke setzte sich neben sie auf den Fußboden, lachte und wollte sie umfangen, wie er solches in den ersten Tagen ihrer Kerkerzeit getan. Doch Marco packte ihn von hinten an den Schultern, warf ihn um und zertrümmerte ihm fast mit seiner Kette das Hirn.
Dem heraneilenden Gehilfen war es natürlich ein leichtes, den von der langen Gefangenschaft geschwächten Jüngling zu bewältigen. Beide Türken stürzten sich auf ihn und begannen ihn unbarmherzig zu peitschen. Sie schlugen ihn abwechselnd, bis beider Hände vor Ermattung niedersanken. Schimpfreden und Drohungen ausstoßend, entfernten sie sich endlich und ließen den Marco in einer Blutlache zurück.
Im Kerker schwieg alles. Keiner wußte, was zu sagen.
Julia näherte sich dem Marco, soweit ihre Ketten es zuließen, wusch seine Wunden und legte ihm feuchte Umschläge um den Kopf.
Marco öffnete die Augen und sagte:
— Ich bin im Paradies.
Julia küßte ihn auf die Schulter, da sie seine Lippen nicht erreichen konnte und sagte ihm:
— Ich liebe dich, Marco. Du bist so licht.
Alle dachten, daß der Türke am nächsten Tage Marco totschlagen würde. Doch aus irgend welchen Gründen kamen am nächsten Morgen zwei neue Kerkermeister, den Kerker zu reinigen: beide waren düster und beachteten die Gefangenen keineswegs. Hatten nun die Bisherigen Furcht vor der Rache, oder wurden sie abgelöst — dies blieb für den Kerker ein Rätsel.
Marco war einige Wochen lang krank, und Julia pflegte ihn nach Kräften. Doch als Marco wiederhergestellt war, erkrankte Julia.
Eines Abends begann sie laut zu stöhnen, da sie ihre Schmerzen nicht länger verbeißen konnte. Die alte Vanozza erfaßte die Sachlage und hieß sie näherrücken.
Gegen den Morgen gebar Julia ein totes Kind.
— Schade, daß es tot ist, sagte Lorenzo, — es wäre ein prächtiger Halunke geworden! Selten genug trifft einen das Schicksal, im Kerker geboren zu werden.
Cosimo beschimpfte die Vanozza, weil sie Julien geholfen hatte.
— Laß sie, es ist ein Weib, entgegnete ihm die leidende Maria.
Am Morgen kamen die türkischen Kerkermeister, wie immer, schaufelten den kleinen ungetauften Leichnam mit dem Unrat zusammen und trugen ihn irgend wohin fort.
Einige Tage darnach sagte Julia zu Marco nachts, als alle schliefen:
— Marco! Du mußt mich ja verachten. Ich bin gefallen. Du bist der Erste, den ich lieb gewann. Aber ich kann dir nicht mehr die Reinheit meines Körpers hingeben. Gegen meinen Willen hat man mich beschmutzt. Ich bin deiner unwürdig, obwohl ich mich nicht an dir versündigt habe. Ach, wäre ich dir in früherer Zeit begegnet, und hättest du als erster meine Brust gesehen, die kein Mann je zu berühren wagte! Dann gäbe es keine Liebkosung, die ich nicht in mir finden würde, um sie an dich mit aller Hingabe der Liebe und Leidenschaft zu verschwenden. Jetzt aber, Marco, laß mich, und wage es nicht, an mich als an ein Weib zu denken. Wenn es mir schon unmöglich ist, dir als Mitgift die einzige wirkliche Kostbarkeit, die ein Mädchen besitzt, ihren ehrlichen Namen, mitzubringen, so will ich auch nicht, daß du dich späterhin deiner Wahl schämen müßtest. Ich werde dich ewig lieben, doch du sollst nicht an mich denken. Aber so lange uns noch der gerechte Zorn des Herrn in dieser Hölle festhält, o, so lange erlaub mir zuweilen dein Gesicht anzusehen, damit ich die Versuchung überwinden kann, die Todsünde des Selbstmordes zu begehen. Sollte aber die Fürsprache der reinen Jungfrau Maria uns die Freiheit wieder erwirken, so gedenke vielleicht zuweilen jener Seele, der du ewig als ein Leuchten erscheinen wirst. Ich aber werde in der Zelle des Klosters nicht ermüden, Gebete für dich emporzusenden.
Jedoch Marco entgegnete ihr:
— Julia! Du bist der lichte Engel über mir. Niemals noch, sei’s im Traum oder im Wachen, sah ich etwas, was schöner wäre, als dein Bildnis. Du ließest mich wieder an Gottes Barmherzigkeit und an den Duft seiner Paradiese glauben. Denn wenn dort, inmitten der hohen Lilien, solche Menschen sind, wie du, so verlohnt es sich schon, die Qualen auf der Erde zu erdulden. Der Gedanke an dich blendet mich mit blauem Feuer, wie der Blitz. Wenn deine Hände mich berühren, erbebe ich: es ist wie eine glühende, aber süße Kohle, Deine Stimme ist wie ein Vogellied auf der taufrischen Wiese, oder wie das Raunen einer leise schaumgekrönten Welle, nicht weit vom steinigen Ufer. Den Fleck zu küssen, den du berührst, ist meine höchste Bestrebung. Du bist unberührt und in deinem Wesen aller Sünden ledig; die Sünde ist unter dir und du bist immer über ihr, wie der kristallene Himmel immer über den Wolken ist. O, meine Herrin, laß nicht mich entbehren den Regenbogen deiner Blicke.
Da aber kniete Julia nieder und sagte zu ihm:
— Marco! Mein Geliebter! So nimmst du mich denn zur Frau?
Da aber kniete Marco nieder und sagte zu ihr:
— Mädchen! Vor dem Antlitz Gottes des Herren, der alles sieht, nehme ich dich zum Weibe, verlobe mich mit dir und vereinige uns in einem Bunde, den kein Mensch jemals die Macht hat, aufzulösen.
Und so vereinte sie die Ehe, nachts, während alle schliefen und nur die beiden auf den Knien voreinander lagen.
Die christlichen Herrscher konnten den Gedanken natürlich nicht ruhig ertragen, die Ungläubigen in einem Lande zu wissen, in dem sonst der Stellvertreter Christi sich beständig aufhielt. Alfons, der Herzog von Calabrien und Sohn des damaligen Königs von Neapel, berief, um die Türken aus Italien zu verjagen und Otranto wieder mit Neapel zu vereinigen, ein gewaltiges Heer. Papst Sixtus IV. ließ kirchliche Geräte einschmelzen und zu Münzen umprägen, bemannte 15 Galeeren und sandte sie Alfons zu Hilfe. Ein Gleiches taten die Arragonier und Ungarn.
Die ausgezeichnete Tapferkeit der Christen brach den Widerstand der Ungläubigen, denen außerdem der Mut entfiel, als sie vom Tode ihres Sultans Mahomed hörten, der sein ungestümes Leben im Mai des Jahres 1481 beschloß. Die Muselmänner flohen aus Italien und aufs neue nahmen die Neapolitaner die wohledle Stadt Otranto ein.
Inmitten der Befehlshaber des christlichen Heeres befand sich auch Pietro, der Bruder des unglücklichen Fernando Largo, und er beeilte sich, den Aufenthaltsort seiner Nichte auszukundschaften. Man führte Julia aus ihrem Verließ. Sie vermochte kaum, auf ihren geschwächten Füßen zu stehen und unerträglich blendete sie das Licht der Sonne. Jene aber, die ihre Blässe und Magerkeit sahen, konnten sich kaum der Tränen enthalten. Flinke Dienerinnen badeten sie in wohlriechendem Wasser, kämmten ihre Haare, und kleideten sie in leichtes feines Linnen.
Julia war wie von Sinnen, und gab kaum auf die vielerlei Fragen Antwort. Am Tage nach ihrer Befreiung befiel sie eine schwere Krankheit, und mehrere Wochen hindurch war sie dem Tode nahe. Im Fieberwahne kam es ihr vor, als ob sie schon tot sei und zu ewigen Qualen im Fegefeuer verurteilt wäre, und als ob die Teufel auf jede nur denkbare Weise ihren Körper zu peinigen und schänden bestrebt wären. Sie erkannte keinen ihrer Verwandten und alle ihr sich Nähernden flößten ihr Entsetzen und Abscheu ein.
Als sie dank der ärztlichen Kunst und der Fürsorge ihrer Verwandten sich langsam zu erholen begann, schien es ihr, als wäre all das Vergangene, jenes furchtbare Jahr, das sie im unterirdischen Kerker zubrachte, nur eine Erscheinung ihrer Fieberträume. Niemand versuchte es, von den Monaten ihrer Gefangenschaft zu sprechen, und sie selbst bemühte sich, bei ihnen nicht einmal im Gedanken zu verweilen.
Nach ihrer endgültigen Wiederherstellung reiste Julia nach Neapel und wohnte dort bei einem ihrer Onkel. Der heute bereits entschlafene König Fernando gab ihr im Angedenken des Märtyrertodes ihres pflichtgetreuen Vaters eine jährliche Rente von tausend Dukaten. Außerdem gingen als ihr Erbe alle Schlösser und Länder ihres Vaters in vollem Bestande an sie über. Die Schönheit Juliens erblühte in solcher Pracht wie nie zuvor. Auf den Hoffesten setzte sie alle in Verwunderung, und, da sie reich war, so fehlte es ihr nicht an jungen, artigen und hochgeborenen Männern, die sich um ihre Hand bewarben.
Einstmals ging Julia am Hafen, wo die neuen bemerkenswerten Gebäude errichtet waren, mit ihren Dienerinnen spazieren. Plötzlich bemerkte sie in einem kleinen Haufen von Fischern, die an einem Boote standen, den Marco. Er war ganz wie ein Seemann angezogen, trug eine Jacke mit Posamenten und eine rote phrygische Mütze.
Als hätte ein böser Zauberer ihr mit seinem Magierstabe gedroht, wurde es Julien plötzlich traurig und qualvoll zumute. Sie wollte so tun, als hätte sie den Marco nicht bemerkt, doch offenbar hatte er sie bereits gesehen und erkannt. Da schickte Julia eine ihrer Dienerinnen zu dem Marco, und hieß ihn, am Abend desselben Tages bei ihr zu erscheinen. Sie bemerkte noch, wie Marco lächelte und zum Zeichen des Einverständnisses mit dem Kopfe nickte.
Den ganzen Tag über kannte Julia keine Ruhe. Am Abend erschien Marco, jung, frisch, kräftig, kühn. Julia empfing ihn in ihrem Zimmer. Mit ihr waren ihre Freundin Monna Lucrezia und zwei vertraute Dienerinnen. Julia trug ein goldverbrämtes Samtgewand, mit durchbrochenen Ärmeln, ein Perlengeschmeide zierte ihren Hals, und auf die Stirne fiel ihr ein Diamantschmuck herab. Sie saß in einem hohen Sessel bester florentinischer Arbeit.
Ehrfürchtig verbeugte sich Marco vor ihr, wie es ein einfacher Fischer vor einer edlen Signora gewiß tun mußte.
Einige Zeit hindurch wußte Julia nicht, was zu sprechen; dann fragte sie ihn:
— Sage mir, mein Freund, womit beschäftigst du dich jetzt?
Marco sah sie mit seinen schwarzen Augen an, lächelte ebenso wie am Morgen und entgegnete:
— Signora, ich bin ein Fischer, handle mit Fischen und führe zuweilen Waren aus Otranto nach Neapel.
— Und du bist mit deiner Lage zufrieden? fragte Julia.
— Mehr habe ich nicht nötig, als leben und die goldene Sonne und blauen Wellen sehen können, antwortete Marco, und seine Stimme tönte so zart, wie in den Stunden ihrer langen Gespräche im Kerker.
Doch Julia bezwang ihr Herz und sagte nur:
— Ich werde dir auf meine Kosten eine Barke ausrüsten lassen, damit du einen selbständigen Handel beginnen kannst.
Marco senkte den Kopf.
— Ich danke Ihnen, Signora, und will Sie nicht durch eine Weigerung kränken. Erlauben Sie mir nur, die Barke zum Gedächtnis an Sie mit Ihrem Namen zu benennen.
Nach diesen Worten verbeugte sich Marco abermals aufs höflichste und bat um die Erlaubnis, sich entfernen zu dürfen. Nachdem er hinausgegangen war, sagte Julia zu der Monna Lucrezia:
— Ich weiß, daß dieser Mensch an einer Verschwörung gegen meinen Vater teilgenommen hat. Doch da er gleich mir die Einnahme unserer Stadt überlebte, kann ich ihm nicht zürnen. Ich werde tatsächlich für ihn eine Barke ausrüsten lassen, werde aber bitten, daß man ihm verbiete, sich in Neapel zu zeigen. Mag er seine Geschäfte irgendwo um Tarent weiterführen.
Ein unbestellter und dem Henker zum Verbrennen übergebener Brief
 Diesen Brief schrieb mir mein unglücklicher Freund
Alexander Athanatos nach seiner wunderbaren
Rettung als Antwort auf meine dringenden Bitten,
jene fabelhaften Szenen zu beschreiben, als deren
einziger lebendiger Zeuge er verblieb. Den Brief
fingen die Agenten der zeitweiligen Regierung ab
und vernichteten ihn als ein schädliches und sittenloses Werk.
Erst nach dem tragischen Tode meines Freundes, als mir alle
seine hinterlassenen Sachen zugestellt wurden, fand ich inmitten
seiner Papiere das Konzept zu dieser Erzählung; alsdann
erfuhr ich denn auch das Schicksal des eigentlichen
Briefes.
Diesen Brief schrieb mir mein unglücklicher Freund
Alexander Athanatos nach seiner wunderbaren
Rettung als Antwort auf meine dringenden Bitten,
jene fabelhaften Szenen zu beschreiben, als deren
einziger lebendiger Zeuge er verblieb. Den Brief
fingen die Agenten der zeitweiligen Regierung ab
und vernichteten ihn als ein schädliches und sittenloses Werk.
Erst nach dem tragischen Tode meines Freundes, als mir alle
seine hinterlassenen Sachen zugestellt wurden, fand ich inmitten
seiner Papiere das Konzept zu dieser Erzählung; alsdann
erfuhr ich denn auch das Schicksal des eigentlichen
Briefes.
Diese wahrhafte und, soweit ich beurteilen kann, vorurteilslose Geschichte eines der charakteristischen Begebnisse, welche im Beginne jener riesigen geschichtlichen Bewegung, die ihre Anhänger heute die „Welt-Revolution“ nennen, vor sich ging, braucht man, schätze ich, nicht dem Vergessen anheimzugeben. Die Niederschriften Alexanders illustrieren natürlich nur einen winzigen Teil des, was in der Hauptstadt an jenem denkwürdigen Tage des Aufstandes geschah, sind dafür aber für einige Fakten die einzigen Quellen, aus der künftige Historiker ihr Wissen schöpfen werden. Das Bewußtsein dieses Umstandes, schätze ich, veranlaßte den Autor, seine Worte mit besonderer Aufmerksamkeit zu wägen, und, ungeachtet eines gewissen blütenreichen Stiles, im Rahmen strengster historischer Wahrhaftigkeit zu bleiben.
Zum Schluß kann ich nicht umhin, jenem Lande, das mir ein Asyl bot, meine Dankbarkeit auszudrücken und meine Freude darüber, daß es auf der Erde noch einen Ort gäbe, wo sich die Freiheit des gedruckten Wortes bewahrte und wo man ruhig Meinungen aussprechen könne, die nicht unbedingt zu einer Lobpreisung der Zeitweiligen Revolutionären Regierung neigen.
Du weißt, daß ich, wie viele, dem Ausbruche der Revolution völlig unvorbereitet gegenüberstand. Allerdings gingen dunkle Gerüchte, es wäre zum Neujahrstage ein allgemeiner Aufstand angekündigt, aber die letzten unruhvollen Jahre lehrten uns, solchen Warnungen nicht besonders zu trauen. Die nächtlichen Ereignisse kamen für mich völlig unerwartet. Ich hatte beschlossen, das neue Jahr nicht zu feiern, und arbeitete ruhig in meinem Zimmer. Plötzlich versagte die elektrische Leitung. Bevor ich noch eine Kerze anzünden konnte, hörte ich hinterm Fenster das hölzerne Knattern von Schüssen. Man hatte sich schon an diese Töne gewöhnt, und ich zweifelte nicht.
Ich zog mich an und ging auf die Straße hinaus.
Im völligen Dunkel der Winternacht konnte ich eine große Volksmenge, die auf der Straße auf- und abwogte, mehr erraten als sehen. Die Luft war ein Getöse von Schritten und Stimmen. Das Schießen verstummte nicht und mir kam es vor, als bohrten sich die Kugeln in die Wand dicht über meinem Kopfe. Nach jeder Salve freute ich mich, daß der Tod noch vorübergegangen.
Doch die Neugier des Zuschauers überwog die Furcht. Ich zögerte an der Haustür in einem Haufen ebenso unschlüssiger Beobachter, wie ich es war. Wir tauschten kurze Fragen aus. Plötzlich, wie ein durchs Wehr gebrochener Strom, stürzte auf uns eine Menge von Menschen zu, die schreiend in panischer Angst liefen. Wir mußten entweder mit ihnen laufen oder zertreten werden.
Auf dem Ruhmesplatz sah ich mich wieder. Das Rathaus brannte und des Feuerschadens Schein beleuchtete die Umgebung. Ich erinnerte mich an einen Vers Vergils: dant clara incendia lucem. Du kennst den Umfang dieses Platzes. Und sieh, er war so voll, daß es schwer wurde, sich zu bewegen. Ich glaube, dort waren mehrere hunderttausend Menschen. Die vom flüchtigen roten Feuer beschienenen Gesichter waren seltsam und unkenntlich.
Ich fragte viele, was geschehen sei. Es war amüsant, eine Reihe sich widersprechender und unglaublicher Antworten zu hören. Einer sagte, daß die Arbeiter alle wohlhabenden Leute totschlügen. Ein anderer, daß die Regierung alle Nichtvermögenden ausrotte, um der revolutionären Bewegung ein Ende zu machen. Ein dritter, daß alle Häuser unterminiert wären, und eine Explosion der anderen folge. Ein vierter wollte mich davon überzeugen, daß dieses gar keine Revolution sei, sondern ein furchtbares Erdbeben.
Und um diese Zeit, als auf dem Platz vor dem Feuerschein fast ein Viertel der Stadteinwohner plaudernd, verwundert, erregt sich drängte, geschah eben jenes furchtbare Ereignis, von dem du durch die Zeitungen hörtest. Der dumpfe Donner von Geschützsalven tönte, ein feuriger Strich zerschnitt das Dunkel und ein Explosivkörper fiel mitten in die dichteste Ansammlung der Leute. Neues Kreischen übertönte den Lärm und betäubte, fast wie ein körperlicher Schlag. Doch im selben Augenblicke explodierte eine zweite Granate. Dann wieder, wieder und wieder . . .
Das ratlose Ministerium hatte dem Kommandanten der Zentralfestung befohlen, auf alle Volksansammlungen zu schießen.
Wieder begann ein sinnloses Fliehen. Inmitten der springenden Granatensplitter, im drohenden Donner der Geschütze, in welchen die durchdringenden Schreie der Verwundeten drangen, taumelten die Leute zwischen Steinwänden hin, traten auf Gefallene, schlugen die Imwegstehenden mit Fäusten, kletterten auf Fensterbretter, auf Laternen, fielen aufs neue hinab und verbissen sich vor Wut mit den Zähnen in den Füßen der Nebenanstehenden. Dies war Schrecken und Chaos, war Hölle, in der man verrückt werden konnte. Auf welche Weise ich auf den Nordischen Boulevard hinausgestoßen wurde, weiß ich nicht.
Hier begegnete mir eine Abteilung der Revolutionären.
Es waren nicht viele, etwa dreihundert Menschen, nicht mehr, doch es waren organisierte Truppen vor der bestürzten Menge. Um einander zu erkennen, trugen sie ihr Abzeichen: eine rote Binde auf dem Arm. Ihre gemessene Bewegung hielt den Menschenstrom auf. Das sinnlose Fliehen hielt ein, die Menge beruhigte sich.
Beim Lichte der Pechfackeln, das alles umgebende ungewöhnlich und unzeitgemäß erscheinen ließ, erhob sich irgend ein Mensch auf den Sockel der Statue des Nordens und machte ein Zeichen, daß er sprechen wolle. Ich stand ziemlich weit, eng an einem Baum gedrückt, und konnte daher nur den allgemeinen Sinn der Rede hören. Die einzelnen Worte erstarben, ohne bis zu mir zu fliegen.
Der Redner rief zur Ruhe. Erklärte, daß der friedliche Lauf des Lebens nicht gestört würde und daß keinem der Bürger eine Gefahr drohe. Daß im ganzen Lande um diese Stunde dasselbe vor sich ginge wie in der Hauptstadt: überall ginge die Regierung zeitweilig in die Hände der Milizstäbe über. Daß nur eine geringe Zahl von Leuten gerichtet würde, — alle die der gestürzten „uns allen gleich verächtlichen“ Regierung anhingen. Daß über diese Leute das Urteil des Geheimen Gerichtes schon ausgesprochen sei.
Zum Schluß sagte der Redner noch einiges von dem Tage, den man Jahrtausende hindurch erwartet hätte, von der endlich erkämpften Freiheit des Volkes.
Im allgemeinen war die Rede eine der allergewöhnlichsten. Ich dachte, die Menge würde den Schwätzer herunterreißen, ihn verjagen wie einen Narren, der in den Minuten der Gefahr lächerlichen Blödsinn treibt. Doch von allen Seiten hörte ich ungestüme Schreie der Zustimmung. Die noch vor einem Augenblick schwankenden, fassungslosen, verzagten Leute verwandelten sich plötzlich in eine ganze Armee sinnloser und sich aufopfernder Aufrührer. Den Redner trug man auf den Händen, dabei die Revolutionshymne anstimmend.
Da fühlte ich plötzlich die Notwendigkeit, zu sein nicht in der Menge, aber mit Menschen, die gleich mir denken, mit Freunden. In meiner Seele erstand das Bildnis des Domes, und ich begriff, daß in dieser Nacht der Platz eines jeden Gläubigen neben jenen Symbolen sei, die unsere Anbetung schon zum Heiligtume gemacht hatte.
Ich lief auf dem Boulevard so rasch, als ich es nur inmitten der allgemeinen Bewegung konnte. Und schon waren überall die Milizen, welche, da sie die elektrische Leitung noch nicht herzustellen wünschten, eine Beleuchtung aus Fackeln inszenierten. Patrouillen schritten vorüber, die sich um die Ruhe bekümmerten. Hier und dort bemerkte ich kleine Meetings in der Art von jenem, dem ich beiwohnte.
Irgendwo ferne dröhnten zuweilen noch Salven.
Ich bog in den dunklen Gerichts-Prospekt ab, und, mich allmählich an den Weg inmitten des Labyrinthes alter Gäßchen erinnernd, tastete ich mich bis zum Eingang unseres Domes durch.
Die Türen waren geschlossen. Ringsum war es menschenleer.
Ich klopfte an die Türe auf die gewohnte Art und man ließ mich ein.
Die Treppe wurde von einer Lampe nur schwach erhellt.
Und ganz wie Schatten in einem jener Kreise der Danteschen Hölle drängten die Menschen sich, und stiegen hinab und hinauf. Das halbe Dunkel veranlaßte alle, zu flüstern. Und fühlbar war die Anwesenheit eines Druckes in all dem leisen Gespräch.
Ich bemerkte Bekannte, hier waren Hero und Irene und Adamant und Dmitri und Lycius und alle und alle. Man begrüßte sich mit mir. Ich fragte Adamant:
— Was denkst du von all diesem?
Er antwortete mir:
— Ich denke, dies ist das Ultimatum. Dies ist das endliche Scheitern jener neuen Welt, die, vom Mittelalter an gerechnet, etwa drei Jahrtausende währte. Dies ist die Ära neuen Lebens, welche unsere Epoche mit den Zeiten des russisch-japanischen Krieges und den Feldzügen Karls des Großen im Sachsenlande in ein ganzes vereinigen wird. Wir aber, alle wir zwischen den zwei Welten werden von diesen gigantischen Mühlsteinen zu Staub zermalmt werden.
Ich ging nach oben. Der kaum beleuchtete Saal des Domes schien noch riesiger zu sein. Die Winkel verlängerten sich ins Unendliche. Die Symbole unserer Feierlichkeiten wuchsen geheimnisvoll und verzerrt aus der Finsternis.
Im halben Lichte standen Gruppen von Menschen.
Irgendwo war eines Weibes hysterisches Weinen.
Man rief mich an. Es war Anastasia. Sie saß auf dem Fußboden. Ich ließ mich neben ihr hin. Sie ergriff meine Hand, sie, die gewöhnlich so verhaltene, selbst in den Stunden der Saturnalien, warf sich aufschluchzend an meine Brust und sagte:
— Und so ist alles aus, das ganze Leben, die ganze Möglichkeit zu leben. Lange Geschlechter, hunderte von Geschlechtern bereiteten meine Seele vor. Ich kann nur in der Pracht leben und atmen. Ich hab Flügel nötig, kann nicht kriechen. Ich muß über den anderen sein, ersticke, wenn allzuviele neben mir sind. Mein ganzes Leben liegt in jenen überzarten, jenen verfeinerten Erlebnissen, welche nur die Höhe ermöglicht! Wir, Treibhausblüten der Menschheit, müssen ja in Wind und Staub vergehen. Und ich will nicht, ich will nicht eure Freiheit und Gleichheit! Ich will lieber eure verschlagene Sklavin sein, als ein Genosse eurer Brüderlichkeit!
Sie schluchzte und ihre kleinen Fäuste ballend, drohte sie jemand. Ich suchte sie zu beruhigen, sagte, daß es noch zu früh wäre zu verzweifeln, unvernünftig, dem ersten Eindruck sich hinzugeben. Die Revolutionäre übertrieben natürlich ihren Sieg. Vielleicht würde morgen die Regierung sie aufs neue unterbekommen. Vielleicht wäre ihnen in der Provinz der Umsturz gar nicht gelungen . . . Doch Anastasia hörte mich nicht.
Plötzlich kam alles in Bewegung. Viele standen auf und andere hoben die Köpfe. Licht irrte — und vor dem Altar stand Theodosius.
Zwei Diakonissinnen in weißen Gewändern trugen wie immer die hohen Leuchter vor ihm her. Er selbst war in schneeweißem Chitone, seine dunklen Locken fielen über seine Schultern, sein Gesicht war sehr ruhig und sehr streng. So stand er vor dem Altar, breitete segnend seine Hände und sprach. Seine Stimme drang in die Seele wie Wein.
— Schwestern und Brüder! sagte er, für uns beginnt der Tag der Freude. Unser Glauben kann nicht sterben, denn er ist die ewige Wahrheit des Seins, und selbst unsere Denker tragen dies, wenn auch verborgen, wenn auch unbewußt, in sich. Unser Glaube ist das letzte Geheimnis der Welt, das man in allen Jahrhunderten gleich verehrt, auf allen Planeten. Für uns aber ist jetzt der Tag gekommen unsern Glauben zu bekennen vor allen Zeiten und der Ewigkeit. Wir dürfen uns der höchsten Leidenschaft angeloben: jener vor dem Tode. Erinnert euch, wie oft wir in sinnlicher Verzückung unsere Körper geißelten und wie der Schmerz die Süßigkeit des Verlöbnisses verdoppelte. Der Tod aber wird den Jubel verdreifachen, verzehnfachen. Der Tod wird weit öffnen die Pforten zur Ruhe, die ihr noch nicht wißt, zum blendenden Lichte, das ihr noch nicht kennt. Schwestern! Brüder! Der Augenblick letzter Vereinigung wird wie ein Blitz unser ganzes Sein durchdringen und noch unser letzter Atem wird ein Schrei sein unsagbaren Glückes. O ihr letzten Gläubigen, o ihr letzte Märtyrer des Glaubens, ich sehe, o ich sehe Kränze des Ruhmes auf euren Häuptern!
Ich bin fest davon überzeugt, daß in der Stimme des Theodosius sowohl wie in seinem Blicke eine hypnotische Kraft ist. Unter seinem Einfluß wurden alle im Dome wie umgewandelt. Ich sah ekstatische Gesichter. Ich hörte heroische Ausrufe.
Theodosius befahl, die Hymne zu singen. Jemand setzte sich an die Orgel. Die Luft wogte. Die Melodie erfüllte den dumpfen Raum, strömte zwischen uns hin, verflocht uns alle mit ihrem unüberwindlichen Netz in ein vielgesichtiges Wesen. Die Verse unseres großen Poeten rissen sich unwillkürlich von unseren Lippen los, so wie unwillkürlich der Ozean tönt im Rufe des Windes. Wir waren wie singende Saiten eines großen Orchesters, Stimmen gewaltiger Orgel, rühmend das ewige Rätsel, preisend schöpferische Leidenschaft.
Etwas später rief man mich in den Rat der Ausführenden. Beim Schein der Kerzen versammelten wir uns im gewöhnlichen Zimmer des Rates. Kaum erkennbar waren die göttlichen Fresken an den Wänden. Theodosius war Vorsitzender.
Er sammelte alle Daten über den Lauf des Aufstandes. Die Lage war hoffnungslos. Die ganze Armee ging zu den Revolutionären über. Alle Generäle und höheren Offiziere waren arretiert und größtenteils schon verurteilt. Die Zentralfestung erlag dem Sturmangriff. Sämtliche Regierungsgebäude — das Palais, das Parlament, die Polizeipräfektur — nahm die Miliz ein. Die aus der Provinz kommenden Nachrichten meldeten betreffs der anderen Städte einen ähnlichen Erfolg des Aufstandes.
Die Frage wurde aufgeworfen, was zu tun sei. Die Mehrzahl schlug vor, sich zu ergeben und der Gewalt zu unterwerfen.
Theodosius schwieg zu all diesem. Dann nahm er aus einem Täschchen ein Papier und legte es uns zur Durchsicht vor. Das war eine der Proskriptionslisten des Zentralstabes. In ihr waren all jene aufgezählt, die in unserem Ausführenden Rate saßen, darunter auch ich. Uns alle hatte das Geheime Gericht zum Tode verurteilt.
Ein bedrücktes Schweigen begann. Theodosius sagte:
— Brüder! Lasset uns die Schwächeren nicht in Versuchung führen. Zeigen wir diese Liste allen Gläubigen, so werden viele schwankend werden. Werden hoffen durch Verrat und Abtrünnigkeit sich das Leben zu kaufen. Aber die Liste verheimlichend, lassen wir sie an der großen Ehre teilnehmen, durch die Tat des Todes die Reinheit ihres Glaubens zu besiegeln. Erlauben wir ihnen denn mit uns zu teilen unser dreifach beneidetes Schicksal.
Jemand wollte erwidern, doch zaghaft. Theodosius näherte ruhig das Papier mit den Namen dem Licht und verbrannte es. Wir sahen, wie die kleine Rolle sich langsam in Asche verwandelte. Plötzlich klopfte eine Diakonissin. Ein Vertreter des Stabes begehrte uns zu sprechen.
Ein junger, entschlossener, zuversichtlicher Mensch trat ein. Im Namen der zeitweiligen Regierung verlangte er, daß ein jeder von uns sich in seine Wohnung verfüge. Ein besonderes Komitee würde, dies waren seine Worte, das Statut eures religiösen Bundes durchsehen und feststellen, ob er dem gesellschaftlichen Leben unschädlich sei.
Wir wußten, daß diese Worte nur Betrug seien, da wir schon verurteilt waren. Einige Augenblicke schwiegen alle. Die alsdann gesprochenen zwei Reden — die des Theodosius und jene des Abgesandten — kann ich auswendig. In kurzen Worten sprachen sich in ihnen zwei Weltanschauungen aus.
Dieses sprach Theodosius:
— Die neue Regierung spricht umsonst mit uns diese lügnerische Sprache. Uns ist es schon bekannt, daß wir alle vom Geheimen Gericht zur Hinrichtung verurteilt sind. Wir wissen, daß unser heiliger Glauben von euch schon von vornherein als unsittliche Sekte gebrandmarkt ist. Aber wir erkennen eure Gewalt und euer Gericht nicht an. Wir stehen auf jenen Höhen der Erkenntnis, die ihr niemals erreichtet, und darum ist es nicht an euch, uns zu richten. Wenn ihr nur ein wenig bekannt seid mit dem Kulturleben eurer Heimat, so seht die hier Versammelten an. Wer sind diese? Die Blüte unserer Zeit: eure Poeten, Künstler, Denker. Wir sind der Ausdruck, wir, die Stimme jenes Lautlosen, Ewigstummen, das sich aus Einsen gleich euch zusammensetzt. Ihr seid die Finsternis; wir, das aus ihr sich gebärende Licht. Ihr, die Möglichkeit des Lebens; wir — das Leben. Ihr seid der Boden, der not und nützlich ist nur dazu, daß aus ihm wachsen könnten Stengel und Blüten — also wir. Ihr verlangt, wir sollen uns in unsere Häuser begeben und dort eure Dekrete erwarten. Wir verlangen, daß ihr auf den Händen uns zum Palais trüget und auf den Knien liegend unseren Willen entgegennähmet.
Du kennst ja den Theodosius. Kennst alle seine Fehler: seine Heuchelei und Kleinmütigkeit, seine kleinliche Ruhmsucht. Doch dieses Mal, seine letzte Predigt sprechend, war er wirklich groß und schön. Er war wie ein biblischer Prophet, sprechend zu aufrührerischem Volke, oder wie ein Apostel erster Christenzeit, irgendwo in den Katakomben des Kolosseums, inmitten Scharen von Märtyrern, die gleich in die Arena hinausgeführt werden, den Raubtieren zum Zerfleischen.
Und dieses antwortete der Abgesandte dem Theodosius:
— Umso besser, wenn ihr euer Los schon kennt. Tausendjährige Versuche zeigten uns, daß morschen Seelen kein Platz im neuen Leben sei. Sie waren eine tote Kraft, die bisher all unsere Siege verhinderte. Nun, am Tage der großen Umgestaltung der Welt, entschlossen wir uns zu einem unumgänglichen Opfer. Wir wollen all die Toten, all die zur Neugeburt unfähigen von unserem Körper abhauen, wenn auch mit gleichem Schmerze, so doch auch mit gleicher Unerbittlichkeit, mit der man einen kranken Körperteil abschneidet. Und warum rühmt ihr euch, daß ihr Poeten und Denker wäret! In uns ist genug Kraft um ein ganzes Geschlecht von Weisen und Künstlern zu gebären, wie sie die Erde noch nie gesehen, wie ihr sie auch nicht einmal zu ahnen vermöget. Nur der fürchtet zu verlieren, in dem keine Kraft ist zu schaffen. Wir sind die schöpferische Kraft. Wir brauchen nichts Altes. Wir sagen uns von jedem Erbe los, weil wir uns unsere Schätze selbst schmieden wollen. Ihr seid das Vergangene, wir, das Künftige, aber das Gegenwärtige, das ist das Schwert in unseren Händen!
Lärm erhob sich. Alle sprachen gleichzeitig. Ich mußte schreien:
— Ja! Barbaren seid ihr, die keine Vorfahren haben. Ihr verachtet die Kultur der Jahrhunderte, weil ihr sie nicht begreift. Ihr rühmt eure Zukunft, weil ihr geistig arm seid. Ihr seid eine Kugel, die schamlos den Marmor des Altertums zerschlägt!
Der Abgesandte des Milizstabes sagte zuletzt in offiziellem Tone:
— Im Namen der zeitweiligen Regierung geb ich euch Zeit bis zum heutigen Mittag. In dieser Zeit habt ihr die Pforten eures Domes zu öffnen und euch in unsere Hände zu geben. Nur so werdet ihr hunderte von Leuten, die ihr durch Trug und Verführung an euch zogt, vor unnützem Tode bewahren. Das ist alles.
— Und wenn wir nicht gehorchen? fragte Lycius.
— Werden unsere Geschütze dieses Gebäude dem Erdboden gleich machen, und euch alle werden die Trümmer begraben.
Der Abgesandte entfernte sich.
— Den Dom zerstören! wiederholte Lycius, unseren Dom, die wundervollste Schöpfung Leanders! Mit Statuen und Bildern der größten Meister! Mit unserer Bibliothek, der fünftgrößten in der Welt!
— Mein Freund, entgegnete Adamant, für jene ist unsere Kunst schon Archäologie. Ob nun in ihren Museen zehn unnütze Altertümer mehr sind oder nicht, — ist ihnen unwichtig.
Jemand sprach sein Bedauern darüber aus, daß man den Abgesandten lebend hinausgelassen. Theodosius hieß ihn schweigen.
— Wir sind hier, sagte er, um unser Blut zu vergießen, nicht fremdes. Wir sind hier für eine Tat des Glaubens, nicht des Mordes. Lasset uns die purpurne Blässe unseres Martyrtumes nicht verdüstern durch die schwarzen Flügel des Zornes und der Rache.
Durch die schweren Stores drang kaum ein Strahl des flimmernden Wintertages.
Unser Dom war völlig von Kerzen erleuchtet. Zum erstenmal sah ich solch eine Feier des Lichtes. Es waren vielleicht an tausend Flammen.
Theodosius befahl die Liturgie abzuhalten.
Noch nie war er so gewaltig. Noch nie erklangen die Stimmen des Chores so feierlich. Noch nie war die Schönheit der nackten Hero so flammend und so verzückend.
Der berauschende Rauch der Weihbecken liebkoste unsere Gesichter als wie mit schlanken flaumigen Fingern. Im schattenhaft bläulichen Weihrauch geschahen die großen Handlungen vor dem Symbole. Ihrer Rangstufe folgend, nahmen die nackten Jünglinge die Hüllen vom Heiligtum. Der unsichtbare Chor der Diakonissinnen lobpries das Blinde Rätsel.
Fast gar nicht berauschend, erregte ein aromatischer süßglühender Wein jedes Beben des Leibes, jedes Verlangen der Seele. Beflügelte jeden durch die Erkenntnis, daß dieser Augenblick einzig und nicht zu wiederholen sei.
Hero in den goldenen Sandalen, mit einer goldenen Schlange als Gürtel anstatt jeder anderen Gewandung, und ihre zwölf Schwestern, die gleich ihr angetan waren, — sie gingen in einem leisen wiegenden Rundtanz durch den Dom. Die magischen Orgeltöne und das harmonisch-geheime Singen zogen jeden hinter ihr her, lenkte alle Blicke auf ihr gemessenes Wiegen.
Unmerklich, unfühlbar, unwillkürlich, folgten wir alle ihrem leisen Tanz. Und dieses Kreisen berauschte mehr als Wein, und diese Bewegung war trunkener als Liebkosungen, und dieser Gottesdienst übertraf jedes Gebet. Der Rhythmus der Musik wurde schneller, und schneller wurde auch der Rhythmus des Tanzes, und mit ausgestreckten Armen strebten wir vorwärts, im Kreise, ihr nach, der einzigen, der göttlichen, — Hero. Und schon entrückte uns die Ekstase, und schon keuchten wir, durchglüht von geheimem Feuer, und schon zitterten wir, beschattet von der Gottheit.
Da ertönte die Stimme des Theodosius.
— Kommet ihr Gläubigen, das Opfer zu vollziehen.
Alle hielten ein, erstarben, wurden unregbar. Hero, die wieder nahe dem Altar stand, erstieg die Stufen. Ein Zeichen des Theodosius rief einen Jüngling herbei, den ich bis dahin noch nicht gesehen. Errötend warf er sein Gewand ab und stellte sich neben Hero, nackt wie ein Gott, jung wie Ganymed, licht wie Balder.
Die Pforten öffneten sich und verschlangen das Paar. Der Vorhang wurde vorgezogen.
Auf den Knien liegende, stimmten wir die Hymne an.
Und Theodosius verkündete uns:
— Es ist vollbracht.
Er erhob den Kelch und segnete uns.
Es strömten die betörten Töne der Orgel und keiner hatte mehr die Kraft, seine Leidenschaft zu verbergen. Wir umschlangen einander, und im plötzlichen Düster des aufsteigenden Weihrauches suchten sich die Lippen, die Hände, die Leiber. Dies waren Näherungen, Verbindungen, Vereinigungen, waren Schreie, Stöhnen, Schmerz und Jubel. War die Trunkenheit tausendgesichtiger Leidenschaft, wenn ringsum alle Bilder, alle Formen, alle Möglichkeiten, alle Biegungen weiblicher, männlicher und kindlicher Körper und alle Verzerrtheit und Verzücktheit der verwandelten Gesichter sind.
O noch nie, noch nie, fühlte ich solche Flamme, solche Unersättlichkeit des Verlangens, das vom Leibe zum Leibe eilen hieß in zweifache, dreifache, vielfache Umarmungen. Und nutzlos waren uns die Flagellanten, die an diesem Tage gleich allen von der Ekstase der Leidenschaft ergriffen waren.
Plötzlich, ich weiß nicht auf wessen Geheiß, schoben sich die dichten Hüllen der Vorhänge von den Fenstern und das ganze Innere des Domes ward den Blicken der Außenstehenden enthüllt: das Bildnis des Symbols, die rätselhaften Fresken an den Wänden und die Menschen, die in seltsamen Umschlingungen auf den weichen Teppichen lagen. Ein wütender Schrei drang von der Straße her bis zu uns.
Und schon bohrte sich der erste Schuß mit Getöse in das Spiegelglas der Fenster. Und dem ersten folgten weitere. Die pfeifenden Kugeln durchschnitten die Wände. Die Miliztruppen konnten das Schauspiel nicht ertragen, das sich hier ihren Blicken enthüllte, und hielten daher die angegebene Zeit nicht ein.
Doch es war, als höre keiner die Schüsse. Die von unsichtbarer Hand gespielte Orgel setzte ihr betörendes Lied fort. Des Weihrauches Aroma wogte in der erregten Luft. Und auch im klaren Tageslichte, wie früher beim Scheine der heiligen Kerzen, wurde der Kultus der Leidenschaft nicht geringer.
Hero, die in den Pforten des Altares stand, schwankte als erste und fiel, während ihre Lippen der Schmerz verzerrte. Hier und dort sanken Arme; einige Körper fielen wie in endgültiger Ermattung zusammen.
Es begann ein furchtbares Blutvergießen. Die Kugeln fielen zwischen uns wie Regen, als würde eine gigantische Hand sie schockweise auf uns streuen. Doch von den Getreuen wollte keiner fliehen oder freiwillig die Umarmung lösen.
Alle, alle, auch die Verzagten, auch die Kleingläubigen wurden Helden, wurden Märtyrer, wurden Heilige. Das Todesgrauen floh unsere Seelen, als würde es einem magischen Worte gehorchen. Mit unserem Blute besiegelten wir die Wahrheit unseres Glaubens.
Einige, die getroffen waren, stürzten. Andere, in der Nähe der Gestürzten, drückten ihre Leiber fester aneinander. Und noch die Sterbenden suchten im letzten wütenden Kusse die begonnene Liebkosung zu vollenden. Ersterbende Hände streckten sich noch mit einer sinnlichen Geste. Im Haufen verkrümmter Körper war es schon unmöglich zu erkennen, wer noch liebkoste und wer schon starb. Inmitten der Schreie konnte man unmöglich das Stöhnen der Leidenschaft von dem des Todes unterscheiden.
Irgendwelche Lippen preßten sich auf die meinen und ich fühlte den Schmerz verzückten Bisses, der vielleicht nur der letzte Krampf eines Sterbenden war. In meinen Händen hielt ich einen Körper, der entweder vor gesättigter Lust, oder in letzter Agonie erkaltete. Dann warf auch mich ein dumpfer Schlag auf den Kopf in den Haufen der Körper, zu den Brüdern, zu den Schwestern.
Allein das letzte, was ich sah, war das Bildnis unseres Symboles. Allein das letzte, was ich hörte, war der Ausruf des Theodosius, den tausendfältiges Echo nicht unter den Gewölben des Domes, aber in den unendlichen, von Finsternis beschatteten Gängen meiner Seele wiederholte:
— In deine Hände befehle ich meinen Geist!
Memoiren eines Psychopathen
 Natürlich hielt man mich schon in meiner Kindheit
für entartet. Natürlich wollte man mich davon
überzeugen, daß niemand meine Gefühle teile.
Und ich gewöhnte mich daran, vor den Menschen
zu lügen. Gewöhnte mich daran, platte Worte zu
sprechen von Mitleid und von der Liebe, vom
Glücke, andere Menschen zu lieben. Doch im Innern meiner
Seele war ich überzeugt und bin auch jetzt noch davon überzeugt,
daß der Mensch seiner Natur nach Verbrecher ist. Ich
glaube, daß inmitten aller Empfindungen, die man gewöhnlich
Rausch nennt, nur eine ist, die diesen Namen verdient,
jene, die den Menschen beim Anblick von fremden Leiden
ergreift. Ich glaube, daß der Mensch in seinem Urzustand
nur nach einem Verlangen trägt, die ihm Gleichenden zu
quälen. Die Kultur legte ihre Fessel auf diese natürliche
Regung. Die Jahrhunderte des Sklaventums führten die
menschliche Seele zu dem Glauben, daß fremde Leiden ihr
schmerzlich wären. Und heute weinen die Leute völlig aufrichtig
über andere und leiden mit ihnen. Doch dies ist nur
eine Einbildung und eine Täuschung des Gefühles.
Natürlich hielt man mich schon in meiner Kindheit
für entartet. Natürlich wollte man mich davon
überzeugen, daß niemand meine Gefühle teile.
Und ich gewöhnte mich daran, vor den Menschen
zu lügen. Gewöhnte mich daran, platte Worte zu
sprechen von Mitleid und von der Liebe, vom
Glücke, andere Menschen zu lieben. Doch im Innern meiner
Seele war ich überzeugt und bin auch jetzt noch davon überzeugt,
daß der Mensch seiner Natur nach Verbrecher ist. Ich
glaube, daß inmitten aller Empfindungen, die man gewöhnlich
Rausch nennt, nur eine ist, die diesen Namen verdient,
jene, die den Menschen beim Anblick von fremden Leiden
ergreift. Ich glaube, daß der Mensch in seinem Urzustand
nur nach einem Verlangen trägt, die ihm Gleichenden zu
quälen. Die Kultur legte ihre Fessel auf diese natürliche
Regung. Die Jahrhunderte des Sklaventums führten die
menschliche Seele zu dem Glauben, daß fremde Leiden ihr
schmerzlich wären. Und heute weinen die Leute völlig aufrichtig
über andere und leiden mit ihnen. Doch dies ist nur
eine Einbildung und eine Täuschung des Gefühles.
Man kann aus Wasser und Spiritus eine Mischung herstellen, in welcher das Provenceröl in jeder Lage im Gleichgewicht bleibt, nicht aufsteigt und nicht hinuntersinkt. Anders gesprochen: die Anziehung der Erde verliert ihre Wirkung auf das Öl. In den physikalischen Lehrbüchern heißt es, daß zufolge des Bestrebens seiner Atome das Öl dann die Form einer Kugel annimmt. Diesem ähneln die Augenblicke, in denen die menschliche Seele sich von aller Macht der Anziehung befreit, von allen Ketten, die Abstammung und Erziehung ihr auferlegten, sowie von allen äußeren Einflüssen, die gewöhnlich unseren Willen bedingen: von der Furcht vor dem letzten Gericht, von dem Bangen vor der öffentlichen Meinung usw. Das sind nicht Stunden des gewöhnlichen Schlafes, in welchen das tägliche Bewußtsein, wenn auch dämmernd, doch immer noch unser schlafendes Ich leitet; das sind auch nicht Tage des Irrsinns und der Geisteszerrüttung: die gewöhnlichen Einflüsse werden von anderen, von noch mehr selbstherrlichen abgewechselt. Das sind Augenblicke jenes seltsamen Zustandes, in dem der Körper im Schlafe ruht, und der Gedanke dies plötzlich begreift und zu seinem in der Welt der Träume irrenden Schatten spricht: du bist frei! Begreife, daß deine Handlungen nur für dich selbst existieren und du wirst dich freiwillig deinen eigenen, aus der dunklen Tiefe deines Willens aufsteigenden Trieben hingeben. In solchen Augenblicken hatte ich niemals das Verlangen, irgend eine gute Tat auszuführen. Im Gegenteil, wissend, daß ich bis zu den letzten Grenzen völlig unbestraft bleiben würde, beeilte ich mich, irgend etwas Wildes, Böses und Sündiges zu tun.
Immer schon liebte ich den Traum. Niemals hielt ich die Zeit, die ich im Traume verbrachte, für verloren. Völlig gleich der Wirklichkeit erfüllt auch der Traum die Seele, erregt, freut und schmerzt sie ebenso und muß überhaupt unserem äußeren Leben ganz an die Seite gestellt werden. Streng gesprochen, ist der Traum nur eine andere Wirklichkeit, — welche von diesen man vorzieht, hängt von den persönlichen Neigungen ab. Ich zog schon seit meiner Kindheit den Traum vor. Schon als Knabe zählte ich die Nächte, in denen ich keine Träume sah, zu den schweren Entbehrungen. Wenn ich erwachte, ohne daß ich mich an meinen Traum erinnern konnte, so fühlte ich mich unglücklich. Den ganzen Tag, zu Hause oder in der Schule, quälte ich mein Gedächtnis, um dann plötzlich in einem seiner dunklen Winkel einen Splitter der vergessenen Bilder zu finden und bei einer neuen Anstrengung plötzlich die ganze Herrlichkeit des kürzlich vergangenen Traumlebens vor mir zu haben! Heißhungrig vertiefte ich mich dann in diese auferstandene Welt und stellte alle ihre kleinsten Einzelheiten wieder her. Bei solcher Schulung meines Gedächtnisses erreichte ich, daß ich meine Träume niemals mehr vergaß. Wie Stunden ersehnter Zusammenkunft, so erwartete ich nachts den Traum.
Besonders liebte ich Alpdrücken wegen der erschütternden Kraft der Wirkungen. Ich entwickelte in mir die Fähigkeit, es künstlich hervorzurufen. Ich brauchte nur einzuschlafen, indem mein Kopf tiefer als der Körper lag, und sofort schon preßte mich ein Alpdrücken mit süßquälenden Krallen. Fast erstickend erwachte ich in einer unnennbaren Zerschlagenheit, doch kaum hatte ich etwas frische Luft eingeatmet, beschloß ich, wieder hineinzustürzen in jenen schwarzen Grund, in Entsetzen und Erbeben. Doch noch mehr liebte ich schon in meinen frühen Jahren jene Traumzustände, wenn man es weiß, daß man schläft. Schon damals begriff ich, welche große Geistesfreiheit sie geben könnten. Übrigens verstand ich es nicht, sie willkürlich hervorzurufen. Im Traume war es mir, als wenn ich plötzlich einen elektrischen Schlag bekäme, und dann begriff ich mit einem Male, daß die Welt in meiner Gewalt sei. Ich schritt auf den Wegen des Traumes durch seine Paläste und Täler, wohin ich wollte. Bei hartnäckiger Anstrengung des Verlangens konnte ich mich sogar in jeder Umgebung sehen, die mir gefiel, konnte in meinen Traum jede Person einführen, nach der ich Verlangen trug. In meiner ersten Kindheit benutzte ich diese Augenblicke, um mich über die Leute lustig zu machen und alle möglichen Streiche auszuführen. Doch mit den Jahren ging ich zu anderen mehr erlesenen Freuden über: ich vergewaltigte Frauen, ich mordete und wurde zum Henker. Und da erst begriff ich, daß Jubel und Rausch nicht nur leere Worte seien.
Die Jahre vergingen. Es vergingen auch die Tage der Schule und der Unterwürfigkeit. Ich war allein, ich hatte keine Familie, ich mußte niemals um das Recht zu leben kämpfen. Ich hatte die Möglichkeit, mich meinem Glücke ungeteilt hingeben zu können. Im Traum und Halbschlaf verbrachte ich den größten Teil der Tage. Ich gebrauchte verschiedene narkotische Mittel: nicht wegen der von ihnen ausgehenden Entzückungen, sondern um meinen Traum zu verlängern und zu vertiefen. Erfahrung und Gewöhnung gaben mir die Möglichkeit, mich immer öfter und öfter an der grenzenlosesten aller Freiheiten, die ein Mensch nur erträumen kann, zu berauschen. Allmählich begann sich mein nächtliches Bewußtsein in diesen Träumen an Stärke und Helligkeit dem des Tages nicht nur zu nähern, sondern vielleicht es auch zu übertreffen. Ich verstand es, in meinen Träumen zu leben, wie auch dieses Leben von der Seite her zu beobachten. Es war, als würde ich meinen Schatten, der im Traume dieses oder jenes tat, beobachten und leiten und zu gleicher Zeit doch alle seine Empfindungen mit ganzer Leidenschaftlichkeit durchleben.
Ich erschuf mir für meine Traumgesichte eine passende Umgebung. Das war irgendwo tief unter der Erde ein geräumiger Saal. Er wurde vom roten Feuer zweier riesiger Öfen beleuchtet. Die Wände waren augenscheinlich eisern. Der Boden aus Stein. Dort befanden sich alle üblichen Marterapparate: Schrauben, Pfähle, Sitze mit spitzen Nägeln, Geräte zum Strecken der Muskeln und zum Aufwickeln der Gedärme, Messer, Zangen, Peitschen, Sägen, glühende Stangen und Rechen. Wenn ein glückseliges Geschick mir wieder die Freiheit gab, trat ich überzeugungsvoll in meinen geheimnisvollen Schlupfwinkel. Mit riesiger Willensanstrengung gelang es mir, wen ich wollte, in diese unterirdische Halle zu führen, zuweilen meine Bekannten, öfters aber solche, die nur in meiner Einbildung lebten; meistens waren es Mädchen und Jünglinge, schwangere Frauen und Kinder. Unter ihnen befanden sich auch einige, die ich zu meinen Lieblingsopfern erwählte. Ich kannte ihre Namen. An einigen lockte mich die Schönheit ihres Körpers, an anderen ihr tapferes Ertragen der größten Qualen, ihre Verachtung aller meiner Listen, während ich bei den dritten im Gegenteil ihre Schwäche, Willenslosigkeit, ihr Stöhnen und unnützes Beten liebte. Zuweilen und nicht einmal selten ließ ich auch die von mir bereits zu Tode gequälten wieder auferstehen, um mich noch einmal an ihrem Märtyrertode zu erfreuen. Anfangs war ich ganz allein, sowohl Henker als auch Zuschauer. Dann aber erschuf ich mir eine Schar unförmlicher Zwerge zu Gehilfen. Ihre Zahl wuchs nach meinem Belieben. Sie reichten mir die Marterinstrumente und lachend und mit Verrenkungen führten sie alle meine Befehle aus. Und mit ihnen feierte ich meine Orgien des Blutes und Feuers, der Schreie und Flüche.
Wahrscheinlich wäre ich so wahnsinnig, einsam und glücklich, wie ich es war, geblieben. Doch die wenigen Freunde, die ich noch hatte, hielten mich für krank und nahe dem Irrsinn, und wollten mich retten. Fast mit Gewalt zwangen sie mich, auszufahren, in Theater und Gesellschaften zu gehen. Ich hege auch den Verdacht, daß sie jenes Mädchen, das nachher meine Frau wurde, mir absichtlich in dem allerreizvollsten Lichte zeigten. Übrigens würde sich wohl kaum ein Mensch gefunden haben, der sie nicht der Anbetung würdig erklärt hätte. Alle Reize der Frau und des Menschen vereinten sich in ihr, die ich lieb gewann, die ich so oft mein nannte, und die ich in allen Tagen meines Lebens, die mir übrig geblieben sind, nicht aufhören werde, zu beweinen. Ihr aber zeigte man mich als einen Leidenden, als einen Unglücklichen, den man retten müsse. Sie begann mit Neugierde und ging dann zu der vollen, selbstvergessenden Leidenschaft über.
Lange Zeit hindurch wagte ich nicht, an eine Heirat zu denken. Wie stark das Gefühl auch war, das meine Seele unterjochte, mich erschreckte der Gedanke, meine Einsamkeit zu verlieren, die mir solche Weiten, in denen ich in Freiheit mich an meinen Traumgesichten berauschen konnte, erschloß. Doch das regelmäßige Leben, zu dem man mich zwang, trübte allmählich meine Erkenntnis. Aufrichtig begann ich, daran zu glauben, daß mit meiner Seele eine Umgestaltung geschehen könne, daß sie ihrer von den Leuten nicht anerkannten Wahrheit entsagen würde. Am Tage meiner Hochzeit gratulierten mir meine Freunde wie einem aus dem Grabe zur Sonne Erstandenen. Nach der Hochzeitsreise bezogen meine Frau und ich ein neues helles und heiteres Heim. Ich begann mir vorzureden, daß mich die Weltereignisse und Stadtneuigkeiten interessierten; ich las Zeitungen und unterhielt einen regen Verkehr. Und wieder lernte ich, am Tage munter zu sein. Nachts, inmitten der entrückten Liebkosungen zweier Liebender überfiel mich gewöhnlich ein toter, flacher Schlaf, der ohne Weiten war, ohne Bilder. In der kurzen Zeit meiner Blindheit war ich bereit, mich meiner Genesung zu freuen, meines Erwachens aus Wahnsinn zur Alltäglichkeit.
Doch natürlich niemals, o niemals! erstarb in mir das Verlangen nach anderen Trunkenheiten. Es wurde nur von der allzu faßbaren Wirklichkeit betäubt. Und selbst in den Flitterwochen des ersten Monats nach der Hochzeit fühlte ich irgendwo in den Tiefen meiner Seele den unersättlichen Hunger nach blendenderen und mehr erregenden Empfindungen. Mit jeder neuen Woche quälte mich dieses Verlangen immer unbesiegbarer. Und gleichzeitig mit ihm entstand in mir ein anderes unbezwingliches Verlangen, daß ich mir anfangs gar nicht einmal eingestehen wollte: das Verlangen, sie, meine Frau, die ich liebte, zu meiner nächtlichen Feier zu bringen, und ihr Gesicht bei den Qualen ihres Leibes verzerrt zu sehen. Ich kämpfte, kämpfte sehr lange und bemühte mich, meine Nüchternheit zu bewahren. Ich war bestrebt, mich mit allen Vernunftsgründen zu überzeugen, doch ich konnte ihnen nicht glauben. Und umsonst suchte ich Zerstreuung und floh das Alleinsein mit mir, die Versuchung wuchs in mir, und ich konnte ihr nicht entfliehen.
Und endlich gab ich ihr nach. Ich tat so, als hätte ich eine große religionsgeschichtliche Arbeit vor. In meine Bibliothek stellte ich breite Divans und verbrachte dort ganze Nächte. Etwas später verbrachte ich dort auch ganze Tage. Auf alle nur mögliche Weise verhüllte ich mein Geheimnis vor meiner Frau; ich zitterte bei dem Gedanken, daß sie in das eindringen würde, was ich so eifersüchtig hütete. Sie war mir noch ebenso teuer, wie zuvor. Ihre Liebkosungen waren mir nicht minder süß, wie in den ersten Tagen unseres Zusammenlebens. Doch eine größere Wollust trieb mich jetzt. Ich konnte ihr mein Benehmen nicht erklären. Ich zog es sogar vor, sie bei dem Gedanken zu lassen, daß ich sie nicht mehr liebe und ein Zusammensein mit ihr vermiede. Und tatsächlich glaubte sie das, quälte sich und wurde müde. Ich sah, wie sie bleicher wurde und hinschwand, sah, daß der Gram sie zum Grabe führen würde. Doch wenn ich, dem Triebe mich hingebend, ihr die früheren Liebesworte sprach, erblühte sie nur auf Augenblicke: sie glaubte mir nicht mehr, weil, wie es ihr schien, alle meine Taten meinen Worten widersprachen.
Doch wenn ich auch, wie früher, ganze Tage im Traume zubrachte und mich meinen Erscheinungen noch ungeteilter als vor der Hochzeit hingab, irgendwie hatte ich meine frühere Fähigkeit, völlige Freiheit zu gewinnen, verloren. Ganze Wochen verbrachte ich auf meinen Divans, erwachte nur, um mich mit ein wenig Wein oder Bouillon zu stärken und um eine neue Dosis des Schlafmittels einzunehmen, allein der erwünschte Augenblick kam nicht. Ich durchlebte die süßen Qualen des Alpdrückens, seine Pracht und Unerbittlichkeit, ich konnte mich an die Reihe der vielgestaltigen Träume erinnern, und sie vor mir aufrollen lassen, die Träume, die so konsequent und furchtbar in dieser triumphierenden Folgerichtigkeit waren, so wild und unlogisch, so entzückend und prachtvoll in dem Wahnsinn ihrer Verbindung, aber meine Erkenntnis blieb, wie von einem Wölkchen umhüllt. Mir fehlte die alte Macht, über den Traum zu verfügen, ich konnte nur jenes, was mir von außen herkam, belauschen und beschauen. Ich griff zu allen mir bekannten Mitteln und Rezepten, zu allen existierenden Giften: störte künstlich die Blutzirkulation, hypnotisierte mich selbst, gebrauchte Opium, Haschisch und alle anderen betäubenden Gifte, doch sie gaben mir nur ihre eigenen Zauber. Erwachend gedachte ich mit sinnloser Wut der anreizenden Erscheinungen, in denen ich kraftlos, wie ein Spielzeug eines fremden Willens, begraben war, und über die ich nicht zu herrschen vermochte. Ich verging vor Wut und Verlangen, aber, wie gesagt, ich war kraftlos.
Seit jener Zeit, in der ich zu dem unterbrochenen Rausch der Träume zurückkehrte, vergingen sechs Monate bis zu dem Tage, da mein verheißenes Glück wiederum mir zurückgegeben wurde. Im Traume fühlte ich plötzlich den mir so gut bekannten elekrischen Schlag und begriff, daß ich frei sei, daß ich schliefe, doch stark genug sei, über den Traum zu verfügen, daß ich alles ausführen könne, wonach ich verlangte und daß es doch nur ein Traum bleiben würde! Eine Welle unsagbaren Jubels überströmte meine Seele. Und da konnte ich auch schon nicht mehr der alten Versuchung widerstehen. Allerdings verlangte ich nicht mehr nach meiner unterirdischen Halle. Ich zog es vor, mich in jene Umgebung zu versetzen, an die sie gewöhnt war, die sie sich selbst hergestellt hatte. Dies war ein noch mehr verfeinerter Genuß. Und gleichzeitig mit meinem zweiten Traumbewußtsein sah ich mich selbst in der Tür meiner Bibliothek stehen.
„Gehen wir, sagte ich zu meiner Erscheinung, gehen wir, sie schläft jetzt und nimm einen schmalen Dolch mit dir, dessen Griff von Elfenbein sei.“
Ich gehorchte und ging den gewöhnlichen Weg durch die dunklen Zimmer. Es kam mir so vor, als würde ich nicht gehen, und nicht meine Füße bewegen, sondern fliegen, wie das ja immer im Traume so ist. Als ich durch den Saal ging, sah ich durchs Fenster die Dächer der Stadt und dachte: „dies alles ist in meiner Gewalt.“ Die Nacht war ohne Mondschein, aber am Himmel funkelten die Sterne. Unter den Sesseln krochen meine Zwerge hervor, doch ich ließ sie verschwinden. Lautlos öffnete ich die Türe zum Schlafzimmer. Das Zimmer wurde von einem Lämpchen genügend erhellt. Ich trat an das Bett heran, in dem mein Weib schlief. Da lag sie, so schwach, so klein, so mager; ihre Haare, die sie des Nachts in zwei Zöpfe flocht, hingen vom Bett herunter. Neben dem Kopfkissen lag ein Tuch: sie hatte wohl geweint, da sie sich niederlegte, darüber geweint, daß sie mich wieder nicht erwarten konnte. Ein bitteres Gefühl schnürte mein Herz zusammen. In diesem Augenblick war ich bereit, an Mitleid zu glauben. Ich hatte sogar das Verlangen, vor ihrem Bette niederzuknien und ihre frierenden Füße zu küssen. Doch sofort erinnerte ich mich, daß dieses alles im Traume wäre.
Ein merkwürdig seltsames Gefühl quälte mich. Ich konnte mein geheimes Verlangen befriedigen, mit dieser Frau alles tun, was ich nur wollte. Und doch würde alles das nur mir bekannt bleiben. Und am Tage konnte ich sie wiederum mit allem Rausche der Zärtlichkeit umgeben, sie trösten, lieben und liebkosen . . . Indem ich mich über den Körper meiner Frau bückte, preßte ich mit fester Hand ihre Gurgel zusammen, so daß sie nicht schreien konnte. Jählings erwachte sie, öffnete die Augen und erbebte unter meiner Hand. Doch ich nagelte sie förmlich an das Bett, und in dem Bestreben, mich fortzustoßen, krümmte sie sich, war bemüht, mir etwas zu sagen und sah mich mit verstörten Augen an. Einige Sekunden lang sah ich sie voll unsagbarer Erregung an, dann aber stieß ich unter der Decke mit einem Schlage meinen Dolch in ihre Seite. Ich sah, wie sie erzitterte, sich streckte, noch immer nicht zu schreien vermochte, aber ihre Augen füllten sich mit Entsetzen und Tränen entströmten ihnen. Über meine Hand, die den Dolch hielt, floß das klebrige und warme Blut. Dann stieß ich langsam den Dolch mehrere Male in ihren Körper, riß die Decke von ihr und verwundete sie immer mehr, sie, die Nackte, die sich bedecken wollte, aufspringen, fortkriechen. Dann erfaßte ich sie am Kopfe und stieß den Dolch durch ihren Hals, dort, wo die Halsarterie ist, nahm alle meine Kraft zusammen und schnitt ihre Kehle durch. Gurgelnd strömte das Blut hervor, da sie sich noch im Todeskampfe zu atmen bemühte, ihre Hände wollten krampfhaft etwas greifen und fortwischen. Ein wenig später war sie schon unbeweglich.
Da ergriff eine so furchtbare Verzweiflung meine Seele, daß ich mich sofort zu erwachen bemühte, aber ich konnte es nicht. Ich machte alle Willensanstrengungen, ich erwartete, daß die Wände ihres Schlafzimmers plötzlich zerfallen würden, verschwinden, zerschmelzen, daß ich mich auf meinem Divan in der Bibliothek wieder sehen würde. Doch das Alpdrücken ging nicht vorüber. Der blutige und unförmliche Körper meines Weibes lag vor mir auf dem vom Blute überströmten Bette. Und in der Türe drängten sich mit Lichtern schon die Menschen, die hierherstürzten, als sie den Lärm des Kampfes hörten, und ihre Gesichter verzerrte das Entsetzen. Sie sprachen kein Wort, doch alle blickten mich an und ich sah sie.
Da begriff ich plötzlich, daß dieses Mal alles, was geschehen war, nicht im Traume geschah.
Aus dem Archiv eines Psychiaters
 Ich liebte die Spiegel schon seit meinen frühesten
Jahren. Als Kind weinte und zitterte ich oft,
wenn ich in ihre durchsichtig-wahrhaftige Tiefe
blickte. In der Kindheit war es mein Lieblingsspiel,
durch die Zimmer und den Garten zu gehen,
einen Spiegel vor mir herzutragen und in seinen
Abgrund blickend, mit jedem Schritte den Rand zu überschreiten
und vor Schrecken und Schwindlichkeit fast zu ersticken.
Schon als Mädchen begann ich, mein ganzes Zimmer
mit großen und kleinen, getreuen und ein wenig verzerrenden,
klaren und etwas trüben Spiegeln zu füllen. Ich hatte mich
gewöhnt, ganze Stunden, ganze Tage inmitten dieser sich
kreuzenden, in einander übergehenden, taumelnden, verschwindenden
und aufs neue erstehenden Welten zu verbringen.
Meine einzige Leidenschaft wurde es, mich diesen lautlosen
Fernen hinzugeben, diesen Perspektiven ohne Echo, diesen
abgesonderten Welten, welche die unsere durchschneiden und,
im Widerspruch zu der Erkenntnis, mit ihr gleichzeitig und
am gleichen Platze existieren. Diese umgedrehte Wirklichkeit,
die von uns durch die glatte Spiegelfläche getrennt
und dem Tastvermögen irgendwie unerreichbar ist, zog mich
immer an und lockte mich wie ein Abgrund oder ein Geheimnis.
Ich liebte die Spiegel schon seit meinen frühesten
Jahren. Als Kind weinte und zitterte ich oft,
wenn ich in ihre durchsichtig-wahrhaftige Tiefe
blickte. In der Kindheit war es mein Lieblingsspiel,
durch die Zimmer und den Garten zu gehen,
einen Spiegel vor mir herzutragen und in seinen
Abgrund blickend, mit jedem Schritte den Rand zu überschreiten
und vor Schrecken und Schwindlichkeit fast zu ersticken.
Schon als Mädchen begann ich, mein ganzes Zimmer
mit großen und kleinen, getreuen und ein wenig verzerrenden,
klaren und etwas trüben Spiegeln zu füllen. Ich hatte mich
gewöhnt, ganze Stunden, ganze Tage inmitten dieser sich
kreuzenden, in einander übergehenden, taumelnden, verschwindenden
und aufs neue erstehenden Welten zu verbringen.
Meine einzige Leidenschaft wurde es, mich diesen lautlosen
Fernen hinzugeben, diesen Perspektiven ohne Echo, diesen
abgesonderten Welten, welche die unsere durchschneiden und,
im Widerspruch zu der Erkenntnis, mit ihr gleichzeitig und
am gleichen Platze existieren. Diese umgedrehte Wirklichkeit,
die von uns durch die glatte Spiegelfläche getrennt
und dem Tastvermögen irgendwie unerreichbar ist, zog mich
immer an und lockte mich wie ein Abgrund oder ein Geheimnis.
Mich lockte auch jene Erscheinung, die immer, wenn ich an den Spiegel herantrat, vor mir erschien und mein Wesen seltsam verdoppelte. Ich bemühte mich, zu erraten, wodurch jene (die andere Frau) sich von mir unterscheide, und, wie es sein könne, daß ihre rechte Hand meine linke sei und daß alle Finger dieser Hand umgestellt wären, obgleich auf einem von ihnen sich eben mein Verlobungsring befand. Meine Gedanken begannen sich zu verwirren, kaum daß ich in dieses Rätsel eindringen wollte, um es zu lösen. In dieser Welt, wo man sich an alles herantasten kann und wo Stimmen und Töne sind, da lebte ich, die Wirkliche; aber in jener Spiegelwelt, die man nur sehen kann, lebte sie, die Erscheinung. Sie war fast wie ich und doch nicht völlig ich; sie wiederholte alle meine Bewegungen, und doch fiel nicht eine dieser Bewegungen mit dem zusammen, was ich tat. Jene (die andere) wußte, was ich nicht erraten konnte, verfügte über jenes Geheimnis, das auf ewig meinem Verstande verborgen war.
Doch ich bemerkte, daß jeder Spiegel seine eigene Welt hätte, seine ihm eigentümliche. Man stelle auf ein und denselben Ort nacheinander zwei Spiegel, und es werden zwei verschiedene Welten entstehen. Und in verschiedenen Spiegeln erstanden verschiedene Erscheinungen vor mir, die alle mir ähnlich sahen und doch niemals miteinander identisch waren. In meinem kleinen Handspiegel lebte ein naives Mädchen, dessen klare Augen mich an meine früheste Jugend erinnerten. Im runden Boudoirspiegel verbarg sich ein schamloses, freies, schönes, kühnes Weib, das alle die verschiedenen Süßigkeiten der Liebkosungen erfahren hatte. In der viereckigen Spiegeltüre des Schrankes wuchs immer eine strenge, machtvolle, kalte Figur auf mit unerbittlichen Blicken. Ich kannte noch andere Doppelgänger von mir, in meinem Trumeau, in dem zusammenlegbaren, vergoldeten Triptychon, im Hängespiegel mit dem eichenen Rahmen, in dem Halsspiegelchen und in vielen und vielen, die ich bewahrte. All den Wesen, die sich in ihnen verbargen, gab ich Grund und Möglichkeit, zu erscheinen. Nach den seltsamen Gesetzen ihrer Welten mußten sie immer das Bildnis dessen annehmen, der sich vor das Glas stellte. Doch sie bewahrten in dieser angenommenen Äußerlichkeit ihre nur ihnen eigentümlichen Züge.
Es gab Spiegelwelten, die ich liebte; es gab aber auch solche, die ich haßte. Ich liebte es, mich in einige von ihnen auf ganze Stunden zu vertiefen und mich in ihren lockenden Räumen zu verlieren. Andere wiederum vermied ich. Heimlich liebte ich nicht alle meine Doppelgänger. Ich wußte, daß alle mir feindlich gesinnt wären, schon weil sie mein von ihnen gehaßtes Bildnis annehmen mußten. Doch einige der Spiegelfrauen bemitleidete ich, verzieh ihnen ihren Haß und verhielt mich zu ihnen fast freundschaftlich. Es gab aber auch solche, die ich verachtete, deren kraftlose Wut ich zu verlachen liebte, die ich mit meiner Selbständigkeit neckte, und mit der Macht, die mir über sie zustand, quälte. Dagegen gab es auch solche, die stärker als ich waren und sich erkühnten, ihrerseits über mich zu lachen und mir Befehle zu erteilen. Ich beeilte mich, von den Spiegeln, in denen diese Frauen lebten, freizukommen, sah sie nicht an, versteckte, verschenkte und zerschlug sie sogar bisweilen. Doch nach jedem Zerschlagen eines Spiegels mußte ich tagelang weinen, weil ich erkannte, daß ich ein Weltall vernichtet hatte. Und die vorwurfsvollen Gesichter einer vernichteten Welt sahen mich aus den Splittern drohend an.
Den für mich schicksalsvoll gewordenen Spiegel kaufte ich im Herbst auf irgend einem Ausverkaufe. Es war ein großes Trumeau, das sich in Scharnieren bewegte. Es überraschte mich durch die ungemeine Klarheit der Wiedergabe. Seine gespenstische Wirklichkeit veränderte sich bei der geringsten Verschiebung des Spiegels, aber sie war immer selbstständig und schrankenlos lebendig. Als ich während des Ausverkaufs das Trumeau besah, schaute die Frau, die mich in ihm vorstellte, mir mit einer hochmütigen Herausforderung in die Augen. Ich wollte ihr nicht nachgeben, ihr nicht zeigen, daß sie mich erschreckt hätte, kaufte darum das Trumeau und ließ es in mein Boudoir stellen. Als ich in meinem Zimmer allein war, trat ich sofort an den neuen Spiegel heran und heftete meine Augen in die meiner Gegnerin. Doch sie tat dasselbe und so voreinander stehend, begannen wir, wie Schlangen einander mit den Blicken zu durchbohren. In ihrer Iris spiegelte ich mich und sie sich in der meinen. Mein Herz erstarrte und mein Kopf begann sich vor diesem starren Blicke zu drehen. Durch eine Willensanstrengung riß ich endlich meine Augen von den fremden Augen, stieß mit dem Fuß an den Spiegel, so daß er zu schaukeln begann und sich das Bildnis meiner Gegnerin kläglich verzerrte, und verließ das Zimmer.
Seit jener Stunde begann unser Kampf. Am Abend des ersten Tages dieser Begegnung wagte ich nicht, mich dem neuen Trumeau zu nähern; ich war mit meinem Manne im Theater, ich lachte übermäßig, und man hielt mich für sehr lustig. Am andern Tage, im klaren Lichte eines Septembermorgens, betrat ich kühn mein Boudoir und setzte mich absichtlich gerade vor den Spiegel. Im selben Augenblick trat auch jene, die andere, in die Türe, kam mir entgegen, durchschritt das Zimmer und setzte sich mir gegenüber hin. Unsere Augen begegneten sich. Ich las in ihren Augen den Haß auf mich, sie in den meinen den auf sie. Unser zweiter Zweikampf begann, ein Zweikampf der Augen, zweier unerbittlicher Blicke, die befehlend waren, drohend, hypnotisierend. Jede von uns bemühte sich, den Willen ihrer Gegnerin zu besiegen, ihren Widerstand zu zerbrechen und sie ihrem Verlangen Untertan zu machen. Und es müßte furchtbar sein, so von der Seite zwei Frauen zu sehen, die einander regungslos gegenübersitzen, vom magischen Einfluß der Blicke gefesselt sind, und vor psychischer Anspannung das Bewußtsein verlieren . . . Plötzlich rief man mich. Der Zauber schwand. Ich stand auf und ging hinaus.
Nun wiederholten sich unsere Zweikämpfe jeden Tag. Ich begriff, daß diese Abenteurerin absichtlich in mein Haus eingedrungen war, um mich zu verderben, und um in unserer Welt meinen Platz einzunehmen. Doch schon war ich zu schwach, um diesem Kampfe zu entsagen. In dieser Rivalität lag für mich eine geheime Trunkenheit. Und schon in der Möglichkeit einer Niederlage versteckte sich eine süße Versuchung. Zuweilen zwang ich mich ganze Tage hindurch, nicht an das Trumeau heranzugehen, beschäftigte mich mit anderen Dingen, zerstreute mich, doch in der Tiefe meiner Seele blieb immer das Bild meiner Gegnerin, die meine Rückkehr zu ihr geduldig und siegessicher erwartete. Und ich kehrte zurück, und sie trat vor mich hin, noch triumphierender als früher, durchbohrte mich mit dem siegessicheren Blicke und nagelte mich vor sich an meinen Platz. Mein Herz blieb stehen, und in kraftloser Wut fühlte ich mich in der Gewalt dieses Blickes. Zuweilen, wenn ich nicht mit ihr war, kams mir in den Kopf, mein Haus zu fliehen, in eine andere Stadt zu fahren, um mich vor meinem Feinde zu verbergen, doch sogleich begriff ich dann, daß dies unmöglich wäre, daß ich dennoch, gehorsam der lockenden Kraft des feindlichen Blickes, hierher zurückkehren müßte, in dieses Zimmer, zu meinem Spiegel. Zuweilen wollte ich sein Glas zerschlagen, es in Splitter zertrümmern, diese unbekannte und mir drohende Welt vernichten, und zuweilen stürzte ich sogar mit irgend einem schweren Gegenstand in der Hand in Ekstase auf den Spiegel zu, aber das verächtliche Lächeln meiner Gegnerin hielt mich zurück. Ein so erkaufter Sieg wäre das Geständnis ihrer Macht und meiner Niederlage gewesen. Und so dauerte der Kampf, dauerte, um mit dem Siege einer von uns zu enden.
Allein bald schon fühlte ich, daß meine Gegnerin stärker war als ich. Mit jeder neuen Begegnung konzentrierte sich in ihrem Blicke eine immer größer und größer werdende Gewalt über mich. Allmählich verlor ich denn auch die Möglichkeit, sie einen Tag hindurch ganz zu fliehen. Sie befahl mir täglich, mehrere Stunden vor ihr zu verbringen. Sie beherrschte meinen Willen, wie der Magnetiseur den Willen der Somnambule. Sie teilte mein Leben ein, wie die Herrin das Leben der Sklavin. Alles, was sie verlangte, mußte ich ausführen, und ich wurde zum Automaten ihrer schweigenden Befehle. Ich wußte, daß sie bedacht und vorsichtig, aber auf sicherem Wege mich zum Verderben führe, doch ich wehrte mich nicht mehr. Ich erriet ihren geheimen Plan: mich in die Welt der Spiegel zu bannen und selbst in unsere Welt hinauszutreten, doch schon hatte ich keine Kraft mehr, sie zu hindern. Mein Mann, meine Verwandten sahen, daß ich ganze Stunden, ganze Tage, ganze Nächte vor dem Spiegel verbrachte; sie hielten mich für verrückt und wollten mich heilen. Ich aber wagte es nicht, ihnen die Wahrheit zu enthüllen, es war mir verboten, ihnen die ganze furchtbare Wahrheit zu sagen, das ganze Entsetzen, dem ich entgegenging.
Einer jener Dezembertage vor den Feiertagen war der Tag meines Verderbens. Ich erinnere mich noch an alles, völlig klar, völlig genau bis in die Einzelheiten: in meiner Erinnerung hat sich nichts verwischt. Wie gewöhnlich betrat ich schon früh mein Boudoir, noch bevor es düster wurde. Vor den Spiegel stellte ich einen weichen Sessel ohne Rücklehne, setzte mich, und gab mich ihr hin. Ohne zu zögern, erschien sie auf meinen Ruf, rückte gleichfalls einen Sessel heran, setzte sich und begann mich anzusehen. Dunkle Vorahnungen quälten meine Seele, aber ich hatte nicht die Macht, mein Gesicht zu senken und mußte den frechen Blick meiner Gegnerin in mir aufnehmen. Die Stunden vergingen, und es wurde finster. Keine von uns beiden zündete Licht an. Leise nur glänzte in der Dunkelheit das Glas. Und schon war kaum mehr etwas zu sehen, nur die siegessicheren Augen sahen mich mit der alten Kraft an. Ich fühlte weder Zorn noch Entsetzen, wie an anderen Tagen, nur eine unstillbare Trauer und die bittere Erkenntnis, daß ich ganz in der Gewalt der anderen wäre. Die Zeit floß hin, und ich schwamm mit ihr in die Unendlichkeit, in den schwarzen Raum der Schwäche und Willenslosigkeit.
Plötzlich stand sie, die Wiedergespiegelte, von ihrem Sessel auf. Vor dieser Beleidigung erbebte ich. Doch etwas Unbesiegbares, etwas von außen her mich Zwingendes hieß auch mich aufstehen. Und die Frau im Spiegel trat einen Schritt vor. Ich gleichfalls. Und die Frau im Spiegel streckte ihre Hände aus. Ich gleichfalls. Mit ihren hypnotisierenden und befehlenden Augen sah sie mir gerade ins Gesicht und bewegte sich vorwärts, und ich schritt ihr entgegen. Und merkwürdig: trotz all des Entsetzens meiner Lage, trotz all meines Hasses auf meine Gegnerin zitterte irgendwo in den Tiefen meiner Seele der seltsame Trost und die versteckte Freude, daß ich nun endlich in jene geheimnisvolle Welt, zu der ich seit der Kindheit mich hingezogen fühlte, und die mir bis heute verschlossen blieb, hineintreten würde. In einigen Augenblicken wußte ich nicht einmal, wer eigentlich den anderen zu sich zöge: sie mich oder ich sie; verlangte sie nach meinem Platz, oder hatte ich diesen Kampf mir nur erdacht, um sie zu verdrängen.
Doch als meine Hände beim Vorwärtsbewegen am Spiegel ihre Hände berührten, erstarb ich förmlich vor Abscheu. Aber sie faßte mich gewaltig an den Händen und zog mich krampfhaft zu sich. Meine Hände versanken im Glase, als wie in feurigkühlem Wasser. Die Kälte des Glases drang unter furchtbaren Schmerzen in meinen Körper, als ob alle Atome meines Wesens ihr gegenseitiges Verhältnis veränderten. Und schon nach einem Augenblicke berührte mein Gesicht das Gesicht meiner Gegnerin, sahen meine Augen die ihren ganz vor sich, verschmolz ich mit ihr in einem ungeheuerlichen Kusse. Alles verschwand vor diesem quälenden Leiden, dem nichts vergleichbar ist, und aus dieser Ohnmacht erwachend, sah ich vor mir mein Boudoir, auf das ich aus dem Spiegel hinabschaute. Meine Nebenbuhlerin stand vor mir und lachte. Und ich, — o Grausamkeit! — ich, die vor Qual und Erniedrigung erstarb, ich mußte gleichfalls lachen, alle ihre Grimassen wiederholen, ihr triumphierendes und helles Lachen. Und, ehe ich noch meinen Zustand ganz erfassen konnte, drehte sich meine Nebenbuhlerin plötzlich um, schritt zur Türe, verschwand vor meinen Augen und dann befiehl mich die Erstarrung des Nichtseins.
Darnach begann mein Leben als Spiegelbild. Ein seltsames halbbewußtes, wenn auch heimlich süßes Leben. Wir waren viele in diesem Spiegel, dunkle Seelen voll träumender Erkenntnisse. Wir konnten miteinander nicht sprechen, fühlten aber unsere Nähe und liebten einander. Wir sahen nichts, wir hörten nur unklar, und unser Sein war wie eine Ermattung in der Unmöglichkeit, zu atmen. Und nur wenn ein Wesen aus der Menschenwelt an den Spiegel herantrat, konnten wir, die wir plötzlich sein Bildnis annehmen mußten, in die Welt sehen, die Stimmen unterscheiden, mit voller Brust atmen. Ich denke, daß das Leben der Toten ähnlich sein müßte, ein unklares Bewußtsein des eigenen Ich, dunkle Erinnerung an das Frühere und das peinigende Verlangen, wenn auch nur auf einen Augenblick, wieder Gestalt zu gewinnen, zu sehen, zu hören, zu sprechen . . . Und jeder von uns hegte und pflegte den verheißenen Traum, sich zu befreien, einen neuen Körper zu finden und wieder der Welt der Beständigkeit und Unerregtheit anzugehören.
Die ersten Tage fühlte ich mich in meiner neuen Lage sehr unglücklich. Ich wußte und verstand noch nichts. Gehorsam und sinnlos nahm ich das Bildnis meiner Gegnerin an, wenn sie sich dem Spiegel näherte um mich zu verhöhnen. Und sie tat das ziemlich oft. Es bereitete ihr ein großes Vergnügen, vor mir mit ihrer Lebendigkeit und ihrer Realität zu kokettieren. Sie setzte sich und auch ich mußte mich setzen, sie stand auf und triumphierte, da sie sah, daß auch ich aufstand, breitete die Arme aus, tanzte, zwang mich, ihre Bewegungen zu verdoppeln und lachte, lachte, damit auch ich lachen müßte. Sie schrie mir Beleidigungen ins Gesicht, und ich konnte ihr nicht antworten. Sie drohte mir mit der Faust und verspottete meine unbedingte Wiederholungsgeste. Und mit einem Stoße drehte sie dann plötzlich den Spiegel um seine Achse und mit einem Schwunge stürzte sie mich in das Nichtsein.
Allein die Beleidigungen und Erniedrigungen erweckten in mir allmählich die Erkenntnis. Ich begriff, daß meine Gegnerin jetzt mein Leben lebe, meine Toiletten gebrauche, die Frau meines Mannes sei und in der Welt meinen Platz einnehme. Das Gefühl des Hasses und das Verlangen nach Rache wuchsen in meiner Seele wie zwei feurige Blumen auf. Ich begann, mich bitter zu schmähen, weil ich aus Schwäche oder aus verbrecherischer Neugierde ihr die Möglichkeit gab, mich zu besiegen. Ich war überzeugt, daß diese Abenteurerin niemals über mich hätte triumphieren können, wenn ich ihr nicht selbst in ihren Listen geholfen hätte. Und nachdem ich mich ein wenig mit den Bedingungen meines neuen Seins bekannt gemacht hatte, entschloß ich mich, mit ihr in denselben Kampf zu treten, den sie mit mir geführt hatte. Wenn sie, der Schatten, es verstanden hatte, meinen Platz als wirkliche Frau einzunehmen, war denn ich, der Mensch, der nur zeitweilig zum Schatten wurde, nicht stärker als diese Erscheinung?
Ich begann mit einem Umwege. Anfangs stellte ich mich, als quälte mich der Hohn meiner Gegnerin immer unerträglicher. Ich ließ sie absichtlich alle Süßigkeit des Sieges spüren. Und da ich das vergehende Opfer spielte, reizte ich in ihr alle geheimen Henkerinstinkte. Sie fiel auf dieses Lockmittel herein. Das Spiel mit mir lockte sie. Indem sie immer neue Martern für mich ersann, verschwendete sie ihre Phantasie. Sie erfand tausend Listen, um mir immer und immer noch einmal zu beweisen, daß ich nur eine Erscheinung wäre, und daß ich kein eigenes Leben mehr hätte. Bald spielte sie vor mir auf dem Klavier und quälte mich mit der Tonlosigkeit meiner Welt. Bald saß sie vor meinem Spiegel, trank langsam meine geliebten Liköre und zwang mich, so zu tun, als würde auch ich trinken. Bald endlich führte sie in mein Boudoir Menschen, die ich verachtete, erlaubte ihnen vor meinen Augen ihren Körper zu küssen, und überließ es dabei ihnen, zu denken, daß sie mich küßten. Und wenn sie dann mit mir allein war, lachte sie mit bösem und triumphierenden Lachen. Doch dieses Lachen verletzte mich nicht mehr; seine Schärfe trug eine Süßigkeit: meine kommende Rache!
In den Stunden, wenn sie mich kränkte, zwang ich meine Gegnerin unmerklich, mir in die Augen zu sehen, begann ich allmählich, ihren Blick zu beherrschen. Bald lag es schon in meiner Gewalt, ihre Lider zu heben oder zu senken, diese oder jene Bewegung ihres Gesichtes hervorzurufen. Und schon begann ich, zu triumphieren, wenn ich auch dieses unter der Maske des Leides verbarg. Meine seelischen Kräfte wuchsen, und ich erkühnte mich, meinem Feinde zu befehlen: heute wirst du dieses tun, heute wirst du dorthin fahren, morgen wirst du zu mir um diese Zeit kommen. Und sie führte es aus! Ich verwickelte ihre Seele in das Netz meiner Wünsche, spann einen festen Faden, mit dem ich ihren Willen hielt und wenn ich meine Erfolge bemerkte, triumphierte ich insgeheim. Als sie dann einmal in den Stunden ihres Lachens auf meinen Lippen plötzlich das siegessichere Lächeln bemerkte, war es schon zu spät. Sie lief damals in heller Wut aus dem Zimmer, doch während ich wieder in den Schlaf meines Nichtseins zurückfiel, wußte ich doch, daß sie morgen wiederkehren würde, wußte, daß sie mir gehorchen würde! Und der Jubel des Sieges schwebte über meiner willenlosen Schwäche, zerschnitt das Dunkel meines Halbtodes als regenbogenfarbener Fächer.
Sie kehrte zurück! In Zorn und Furcht kehrte sie zu mir zurück, schrie mich an und drohte mir. Ich aber erteilte ihr Befehle. Und sie mußte mir gehorchen. Es war wie das Spiel der Katze mit der Maus. Zu beliebiger Stunde konnte ich sie wieder in die Spiegeltiefe stürzen, selbst aber hinaustreten in die tönende und feste Wirklichkeit. Sie wußte, daß dieses von meinem Willen abhinge, und dieses Bewußtsein quälte sie zweifach. Doch ich zauderte. Es war mir angenehm, zu Zeiten im Nichtsein zu sein. Es war mir angenehm, mich mit der Möglichkeit zu berauschen. Endlich (und dieses ist gewiß merkwürdig) erwachte in mir das Mitleid mit meiner Gegnerin; die mein Feind war, mein Henker. Allein es war in ihr etwas von mir und es war mir furchtbar, sie so aus der Klarheit des Lebens hinauszureißen und sie in einen Schatten zu verwandeln. Ich schwankte und wagte es nicht, verlängerte die Frist von Tag zu Tag und wußte eigentlich selbst nicht, was ich wollte und was mich erschreckte.
Und plötzlich, an einem hellen Frühlingstage, traten in das Boudoir Menschen mit Brettern und Beilen. Ich war unlebendig, ich lag in einer süßen Erstarrung, aber wenn ich auch nichts sah, so begriff ich doch, daß sie hier wären. Die Leute begannen in der Nähe des Spiegels, der mir zum Weltall geworden war, sich zu beschäftigen. Und eine nach der anderen erwachten die Seelen, die mit mir den Spiegel bewohnten, und nahmen den Körper der Erscheinung, die Form des Spiegelbildes an. Furchtbare Unruhe erregte meine träumende Seele. Im Vorgefühle des Entsetzens, im Vorgefühle des schon nicht mehr gutzumachenden Verderbens sammelte ich all die Macht meines Willens. Welche Anstrengung kostete es mich, mit der Entrücktheit eines halben Seins zu kämpfen. So kämpfen lebendige Leute manchmal mit einem Alpdrücken, wenn sie sich aus seinen quälenden Ketten zur Wirklichkeit befreien wollen.
Ich konzentrierte alle Kräfte der Suggestion in den Ruf, den ich ihr, meiner Gegnerin, zurief: „komm her!“ Ich hypnotiserte und magnetisierte sie mit der ganzen Anstrengung meines träumenden Willens. Und ich hatte so wenig Zeit. Schon bewegte sich der Spiegel. Schon hatte man vor, ihn in das Brettergrab zu legen, um ihn fortzuführen: wohin, das war mir unbekannt. Und so in letztem tödlichem Triebe rief ich wieder und wieder: „komm! . . .“ Und plötzlich fühlte ich, daß ich lebendig wurde. Sie, mein Feind, öffnete die Thüre; und bleich und halbtot kam sie mir entgegen, gehorchte sie meinem Rufe, wenn auch mit Schritten, die sich sträubten, als würde sie zum Richtplatz gehen. Mit meinen Augen umschloß ich ihre Augen, fesselte ihren Blick mit meinem Blicke und dann wußte ich, daß ich siegen würde.
Ich zwang sie, die Leute aus dem Zimmer hinauszuschicken. Sie gehorchte und machte nicht einmal den Versuch, sich zu widersetzen. Und wieder waren wir allein. Ich durfte nicht länger zögern. Außerdem konnte ich ihr ihre Tücke nicht verzeihen. Mitleidlos befahl ich ihr, mir entgegenzugehen. Ein Stöhnen der Qual entrang sich ihren Lippen, ihre Augen erweiterten sich wie vor einem Gespenste, doch sie kam, taumelte, fiel, — sie kam. Und auch ich ging ihr entgegen, mit Lippen, welche der Triumph verzog, mit Augen, welche die Freude weit geöffnet hatte, und mit Schritten, die vor trunkenem Jubel taumelten. Und wieder berührten sich unsere Hände, wieder näherten sich unsere Lippen und wir stürzten eine in die andere, verbrannt vom unnennbaren Schmerze der neuen Verkörperung. Und schon nach einem Augenblick stand ich vor dem Spiegel, meine Brust füllte sich mit Luft und ich schrie laut und sieghaft auf und fiel hin, fiel vor dem Trumeau nieder vor Ermattung.
Mein Gatte, die Menschen liefen in das Zimmer. Ich konnte nur sagen, daß man meinen früheren Befehl ausführen möge, diesen Spiegel ganz und für immer aus dem Hause fortzutragen. Dann verlor ich das Bewußtsein.
Man legte mich ins Bett. Man berief einen Arzt. Ich bekam nach all dem Erlebten ein Nervenfieber. Meine Verwandten hielten mich schon lange für krank und unnormal. Im ersten Jubel war ich so unvorsichtig, ihnen alles, was mit mir geschehen war, zu erzählen. Meine Erzählung bestärkte nur ihren Verdacht. Man führte mich in ein psychiatrisches Krankenhaus über, in dem ich mich auch jetzt noch befinde. Ich bin davon überzeugt, daß mein ganzes Wesen noch immer tief erschüttert ist. Doch ich darf nicht lange hier bleiben. Mir blieb noch eine Sache, eine Aufgabe, die ich bald schon ausführen muß.
Ich zweifle nicht an meinem Siege, nein, nein! Ich weiß, daß ich Ich bin. Doch sobald ich an jene denke, die jetzt in meinem Spiegel eingeschlossen ist, so erfüllt mich eine seltsame Ungewißheit: wie, wenn mein wirkliches Ich dort wäre? Dann würde ich selbst, ich, die dieses hier denkt, ich, die dieses hier schreibt, ein Schatten sein, eine Erscheinung, ein Spiegelbild. In mich strömten nur die Erinnerungen, Gedanken und Gefühle jener über, die mein anderes Ich ist, mein wirkliches. Und tatsächlich wäre ich noch immer im Nichtsein der Spiegeltiefe, würde mich quälen, würde ermatten, sterben. Ich weiß, o, ich weiß es fast genau, daß dieses nicht wahr ist. Doch um die letzten Wolken des Zweifels zu zerstreuen, muß ich wieder, nur noch einmal, das letztemal in jenen Spiegel schauen. Noch einmal muß ich in ihn sehen, um mich zu überzeugen, daß dort die Usurpatorin ist, mein Feind, der meine Rolle während einiger Monate spielte. Ich werde dies sehen, und alle Bedrücktheit meiner Seele wird weichen, und ich werde wieder sorgenlos klar und glücklich sein. Wo ist dieser Spiegel, wo werde ich ihn finden? Ich muß, o, ich muß noch einmal hineinschauen, schauen in seine Tiefe! . . .
Erzählung eines Landstreichers
 Man verurteilte ihn wegen Diebstahls zu einem
Jahr Gefängnishaft. Mich intrigierten das Benehmen
des Alten vor dem Gerichte, wie auch
die eigenen Umstände des Verbrechens. Ich erreichte
eine Zusammenkunft mit dem Verurteilten.
Anfangs hatte er eine gewisse Scheu vor mir,
schwieg, dann aber erzählte er mir doch sein Leben.
Man verurteilte ihn wegen Diebstahls zu einem
Jahr Gefängnishaft. Mich intrigierten das Benehmen
des Alten vor dem Gerichte, wie auch
die eigenen Umstände des Verbrechens. Ich erreichte
eine Zusammenkunft mit dem Verurteilten.
Anfangs hatte er eine gewisse Scheu vor mir,
schwieg, dann aber erzählte er mir doch sein Leben.
— Sie haben Recht, begann er, ich sah einst bessere Tage, war nicht immer ein Herumtreiber, schlief nicht immer in den Nachtasylen. Ich genoß eine ganz gute Erziehung, ich wurde ein Techniker. Als ich jung war, da hatte ich schon Geld, lebte geräuschvoll: jeden Tag irgend eine Abendgesellschaft, ein Ball, und alles endete immer mit einem Saufgelage. An diese Zeit erinnere ich mich gut, selbst an Kleinigkeiten. Aber in meinen Erinnerungen ist eine Lücke und um sie auszufüllen, würde ich den ganzen Rest meiner lumpigen Tage hingeben: nämlich alles, was in Bezug zu Nina steht.
Sie hieß Nina, gnädiger Herr, ich bin davon überzeugt, daß sie Nina hieß. Sie war mit einem armen Eisenbahnbeamten verheiratet. Sie waren arm. Aber wie verstand sie es, in dieser kläglichen Atmosphäre vornehm zu sein und so besonders fein! Sie kochte selbst, aber ihre Hände waren wie gemeißelt. Aus ihren billigen Fetzen nähte sie sich wundervolle Träume. Ja und auch alles alltägliche, das mit ihr in Berührung kam, wurde so ungewöhnlich, so phantastisch. Ich selbst wurde unter ihrem Einfluß ein anderer, besserer, schüttelte von mir wie Regentropfen alle Gemeinheit des Lebens ab.
Gott verzeih ihr die Sünde, daß sie mich liebte. Rings war alles so ungeschliffen, daß sie mich lieben mußte, mich, den jungen, hübschen, der so viel Verse auswendig konnte. Doch wo ich mit ihr bekannt wurde und wie, dessen kann ich mich schon nicht mehr entsinnen. Aus dem Dunkel reißen sich einige Bilder. Wir sind im Theater. Sie ist glücklich und lustig (o, wie selten das bei ihr vorkam!), trinkt sozusagen jedes Wort des Schauspieles, lächelt mir zu . . . O, dies Lächeln kenn ich noch. Dann sind wir irgend wo zu zweien. Sie neigt den Kopf und sagt mir: „Ich weiß, du, mein Glück, wirst nicht lange bei mir verweilen; sei es immerhin, ich habe doch gelebt.“ O diese Worte kenn ich noch. Doch was gleich danach war, — und ist dies mit Nina überhaupt wahr? Ich weiß nicht.
Natürlich verließ ich sie. Mir erschien das so selbstverständlich. Vor mir lag eine glänzende Zukunft und ich konnte mich durch irgend eine romantische Liebe nicht binden lassen. Es war mir schmerzlich, sehr schmerzlich, aber ich bekämpfte das und sah darin sogar eine Tat, daß ich dieses Weh überstand. Ich hörte, daß Nina rasch darauf mit ihrem Mann nach dem Süden gereist sei und bald gestorben. Doch Erinnerungen und Gespräche von ihr peinigten mich damals so sehr, daß ich alle Nachrichten vermied. Ich bemühte mich, nicht an Nina zu denken. Weder ihr Porträt noch ihre Briefe hatte ich mehr und nichts erinnerte mich an sie. Und natürlich vergaß ich dann auch ihr Gesicht, ihren Namen, unsere ganze Liebe, begreifen Sie bitte, vergaß alles. Sie verschwand aus meinem Leben, als wäre sie nie darin gewesen. Und es ist etwas Schmähliches für einen Menschen, so zu vergessen.
Nun, die Jahre vergingen. Ich brauche Ihnen wohl nicht zu erzählen, wie ich Karriere machte. Von Nina getrennt, dachte ich natürlich nur an äußeren Erfolg, an Geld. Eine Zeit hindurch erreichte ich fast mein Ziel, lebte im Auslande, heiratete, hatte Kinder. Dann kamen die Verluste: die Frau starb; mit den Kindern vertrug ich mich nicht, gab sie zu Verwandten und, Gott verzeih mir, weiß jetzt nicht mal, ob meine Jungen noch leben. Natürlich trank ich. Dann eröffnete ich ein Geschäft, es kam nichts dabei heraus, ich verlor nur mein letztes Geld und meine letzten Kräfte. Zum Schluß sank ich bis zu dem, als den Sie mich heute hier sehen. In den letzten Jahren beschäftigte ich mich einige Monate, als ich nicht trank, als Arbeiter in den Fabriken. Doch wenn ich trank, kam ich auf den Trödelmarkt und in die Nachtasyle. Auf die Menschen war ich furchtbar wütend und träumte immer, das Schicksal würde sich ändern, ich würde wieder reich werden. Meine neuen Kameraden verachtete ich deshalb, weil sie diese Hoffnung nicht hatten.
So trieb ich mich denn einmal frierend und hungrig auf irgend einem Hofe herum, weiß der Teufel warum, ich glaube, der Zufall führte mich. Plötzlich ruft mich ein Koch an: „Lieber, bist du nicht am Ende ein Schlosser?“ „Das bin ich,“ antwortete ich. Man hieß mich ein Schreibtischschloß zurecht machen. Ich wurde in ein prachtvolles Kabinett geführt; überall Vergoldung und Bilder. Ich arbeitete, reparierte, was nötig war, und die Gnädige gab mir einen Rubel. Das Geld nehmend, erblickte ich plötzlich ein auf einer Säule stehendes Köpfchen aus Marmor. Ich ersterbe, schaue es an und will meinen Augen nicht trauen: es war Nina!
Ich sage Ihnen, lieber Herr, ich hatte Nina völlig vergessen und dort begriff ich es erst, daß ich sie vergessen. Ich schaue, zittere fast und frage: „Gnädige Frau, gestatten Sie zu fragen, was das für ein Köpfchen ist?“ „Das,“ antwortet sie, „ist eine sehr teuere Sache, die vor fünfhundert Jahren gemacht ist, im XV. Jahrhundert.“ Nannte mir auch den Namen des Künstlers, den ich aber nicht behielt, sagte, daß ihr Mann dies Köpfchen aus Italien mitgebracht hätte und hieraus wäre eine ganze diplomatische Affäre zwischen dem italienischen und dem russischen Kabinett entstanden. „Sagen Sie mal,“ fragte mich die Gnädige, „gefällt Ihnen das Köpfchen? Was haben Sie für einen unmodernen Geschmack! Die Ohren,“ sagt sie, „sind nicht am Platze, die Nase ist unregelmäßig . . .“ und schwatzt! und schwatzt!
Wie verhext lief ich aus dem Hause. Das war nicht nur Ähnlichkeit, das war ein Porträt, sogar noch mehr, das war wirkliches Leben im Marmor. Sagen Sie mir bitte, durch welch ein Wunder konnte ein Künstler des XV. Jahrhunderts diese selben mir so bekannten kleinen, ein wenig tief angesetzten Ohren schaffen, diese selben kaum mandelförmigen Augen, die unregelmäßige Nase und die lange zurückgelehnte Stirn, aus denen sich ganz unerwartet das schönste, das reizendste Frauengesicht zusammensetzte? Welch ein Wunder ließ zwei völlig gleiche Frauen leben, die eine im XV. Jahrhundert, die andere — in unseren Tagen? Denn daß jene, nach welcher der Marmorkopf gemacht wurde, nicht nur im Gesicht, sondern auch dem Charakter, der Seele nach völlig gleichartig, ja identisch mit Nina war, kann ich nicht bezweifeln.
Dieser Tag gestaltete mein ganzes Leben um. Ich begriff sowohl die ganze Niedrigkeit meiner Aufführung im Vergangenen, als auch die Tiefe meines Sturzes. Ich begriff, daß Nina der Engel war, den mir das Schicksal sandte und den ich zu erkennen hatte. Es ist unmöglich, das Vergangene ungeschehen zu machen. Doch gierig begann ich, alle Erinnerungen an Nina zu sammeln, so wie man zuweilen die Scherben einer zerbrochenen kostbaren Vase aufliest. O, wenig war es! Trotz aller Mühe konnte ich nichts Ganzes zusammenstellen. Es waren nur Splitter, Trümmer. Doch wie jubelte ich, wenn es mir gelang, in meiner Seele irgend etwas Neues zu finden. Nachdenkend und mich erinnernd verbrachte ich ganze Stunden; man lachte über mich und doch war ich glücklich. Ich bin alt, es ist für mich zu spät, mein Leben von neuem zu beginnen. Aber noch kann ich meine Seele von schlechten Gedanken befreien, von Menschenhaß und vom Murren auf den Schöpfer. Und in der Erinnerung an Nina fand ich diese Reinigung und Befreiung.
Ich hatte ein leidenschaftliches Verlangen, die Statue noch einmal zu sehen. Ich strich ganze Abende in der Nähe des Hauses, in welchem sie stand, herum und bemühte mich, das Köpfchen aus Marmor zu erblicken, doch es stand zu weit von den Fenstern. Ganze Nächte verbrachte ich vor dem Hause. Ich sah alle in ihm Lebenden, merkte mir die Verteilung der Zimmer, knüpfte mit der Bedienung Bekanntschaften an. Im Sommer fuhren die Besitzer aufs Land. Und länger konnte ich mein Verlangen auch nicht bekämpfen. Ich glaubte, daß, wenn ich noch einmal die marmorne Nina ansehen könnte, ich mich an alles erinnern würde, an alles bis zum Ende. Das wäre mein letztes Glück gewesen. Und ich entschloß mich zu dem, wofür man mich verurteilt hat. Sie wissen, daß es mir nicht gelang, man ergriff mich schon im Vorzimmer. Auf dem Gericht stellte sich heraus, daß ich in den Zimmern schon einmal als Schlosser war, und daß man mich nicht selten in der Nähe des Hauses hatte herumlungern gesehen . . . Ich bin ein Bettler, da hab ich dann eben die Schlösser erbrochen . . . Übrigens ist die Geschichte aus, gnädiger Herr!
— Aber wir wollen appellieren, sagte ich, man wird Sie freisprechen.
— Wozu? entgegnete der Alte. Weder betrübt, noch schändet meine Verurteilung jemanden, und ist es nicht imgrunde gleich, wo ich an Nina denke, im Nachtasyl oder im Gefängnis?
Ich fand nichts zu erwidern, doch, indem mich der Alte mit seinen seltsamen verblichenen Augen ansah, sagte er plötzlich noch:
— Eines beunruhigt mich. Wie, wenn Nina niemals existiert hätte? Wenn nur mein armer, durch Alkohol geschwächter Verstand sich die ganze Geschichte dieser Liebe erdacht hätte, während ich das Köpfchen aus Marmor ansah?
Die folgenden Korrekturen am Originaltext wurden vorgenommen:
End of Project Gutenberg's Die Republik des Südkreuzes, by Waleri Brjussow
*** END OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK DIE REPUBLIK DES SÜDKREUZES ***
***** This file should be named 38518-h.htm or 38518-h.zip *****
This and all associated files of various formats will be found in:
http://www.gutenberg.org/3/8/5/1/38518/
Produced by Jens Sadowski
Updated editions will replace the previous one--the old editions
will be renamed.
Creating the works from public domain print editions means that no
one owns a United States copyright in these works, so the Foundation
(and you!) can copy and distribute it in the United States without
permission and without paying copyright royalties. Special rules,
set forth in the General Terms of Use part of this license, apply to
copying and distributing Project Gutenberg-tm electronic works to
protect the PROJECT GUTENBERG-tm concept and trademark. Project
Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you
charge for the eBooks, unless you receive specific permission. If you
do not charge anything for copies of this eBook, complying with the
rules is very easy. You may use this eBook for nearly any purpose
such as creation of derivative works, reports, performances and
research. They may be modified and printed and given away--you may do
practically ANYTHING with public domain eBooks. Redistribution is
subject to the trademark license, especially commercial
redistribution.
*** START: FULL LICENSE ***
THE FULL PROJECT GUTENBERG LICENSE
PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK
To protect the Project Gutenberg-tm mission of promoting the free
distribution of electronic works, by using or distributing this work
(or any other work associated in any way with the phrase "Project
Gutenberg"), you agree to comply with all the terms of the Full Project
Gutenberg-tm License (available with this file or online at
http://gutenberg.org/license).
Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg-tm
electronic works
1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg-tm
electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to
and accept all the terms of this license and intellectual property
(trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all
the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy
all copies of Project Gutenberg-tm electronic works in your possession.
If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project
Gutenberg-tm electronic work and you do not agree to be bound by the
terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or
entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E.8.
1.B. "Project Gutenberg" is a registered trademark. It may only be
used on or associated in any way with an electronic work by people who
agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few
things that you can do with most Project Gutenberg-tm electronic works
even without complying with the full terms of this agreement. See
paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project
Gutenberg-tm electronic works if you follow the terms of this agreement
and help preserve free future access to Project Gutenberg-tm electronic
works. See paragraph 1.E below.
1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation ("the Foundation"
or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection of Project
Gutenberg-tm electronic works. Nearly all the individual works in the
collection are in the public domain in the United States. If an
individual work is in the public domain in the United States and you are
located in the United States, we do not claim a right to prevent you from
copying, distributing, performing, displaying or creating derivative
works based on the work as long as all references to Project Gutenberg
are removed. Of course, we hope that you will support the Project
Gutenberg-tm mission of promoting free access to electronic works by
freely sharing Project Gutenberg-tm works in compliance with the terms of
this agreement for keeping the Project Gutenberg-tm name associated with
the work. You can easily comply with the terms of this agreement by
keeping this work in the same format with its attached full Project
Gutenberg-tm License when you share it without charge with others.
1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern
what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in
a constant state of change. If you are outside the United States, check
the laws of your country in addition to the terms of this agreement
before downloading, copying, displaying, performing, distributing or
creating derivative works based on this work or any other Project
Gutenberg-tm work. The Foundation makes no representations concerning
the copyright status of any work in any country outside the United
States.
1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:
1.E.1. The following sentence, with active links to, or other immediate
access to, the full Project Gutenberg-tm License must appear prominently
whenever any copy of a Project Gutenberg-tm work (any work on which the
phrase "Project Gutenberg" appears, or with which the phrase "Project
Gutenberg" is associated) is accessed, displayed, performed, viewed,
copied or distributed:
This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with
almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or
re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included
with this eBook or online at www.gutenberg.org
1.E.2. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is derived
from the public domain (does not contain a notice indicating that it is
posted with permission of the copyright holder), the work can be copied
and distributed to anyone in the United States without paying any fees
or charges. If you are redistributing or providing access to a work
with the phrase "Project Gutenberg" associated with or appearing on the
work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1
through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the
Project Gutenberg-tm trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or
1.E.9.
1.E.3. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is posted
with the permission of the copyright holder, your use and distribution
must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional
terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked
to the Project Gutenberg-tm License for all works posted with the
permission of the copyright holder found at the beginning of this work.
1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg-tm
License terms from this work, or any files containing a part of this
work or any other work associated with Project Gutenberg-tm.
1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this
electronic work, or any part of this electronic work, without
prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with
active links or immediate access to the full terms of the Project
Gutenberg-tm License.
1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary,
compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including any
word processing or hypertext form. However, if you provide access to or
distribute copies of a Project Gutenberg-tm work in a format other than
"Plain Vanilla ASCII" or other format used in the official version
posted on the official Project Gutenberg-tm web site (www.gutenberg.org),
you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a
copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon
request, of the work in its original "Plain Vanilla ASCII" or other
form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg-tm
License as specified in paragraph 1.E.1.
1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying,
performing, copying or distributing any Project Gutenberg-tm works
unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.
1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing
access to or distributing Project Gutenberg-tm electronic works provided
that
- You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from
the use of Project Gutenberg-tm works calculated using the method
you already use to calculate your applicable taxes. The fee is
owed to the owner of the Project Gutenberg-tm trademark, but he
has agreed to donate royalties under this paragraph to the
Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments
must be paid within 60 days following each date on which you
prepare (or are legally required to prepare) your periodic tax
returns. Royalty payments should be clearly marked as such and
sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the
address specified in Section 4, "Information about donations to
the Project Gutenberg Literary Archive Foundation."
- You provide a full refund of any money paid by a user who notifies
you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he
does not agree to the terms of the full Project Gutenberg-tm
License. You must require such a user to return or
destroy all copies of the works possessed in a physical medium
and discontinue all use of and all access to other copies of
Project Gutenberg-tm works.
- You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of any
money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the
electronic work is discovered and reported to you within 90 days
of receipt of the work.
- You comply with all other terms of this agreement for free
distribution of Project Gutenberg-tm works.
1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg-tm
electronic work or group of works on different terms than are set
forth in this agreement, you must obtain permission in writing from
both the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and Michael
Hart, the owner of the Project Gutenberg-tm trademark. Contact the
Foundation as set forth in Section 3 below.
1.F.
1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable
effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread
public domain works in creating the Project Gutenberg-tm
collection. Despite these efforts, Project Gutenberg-tm electronic
works, and the medium on which they may be stored, may contain
"Defects," such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or
corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual
property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a
computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by
your equipment.
1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the "Right
of Replacement or Refund" described in paragraph 1.F.3, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project
Gutenberg-tm trademark, and any other party distributing a Project
Gutenberg-tm electronic work under this agreement, disclaim all
liability to you for damages, costs and expenses, including legal
fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT
LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE
PROVIDED IN PARAGRAPH F3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE
TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE
LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR
INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a
defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can
receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a
written explanation to the person you received the work from. If you
received the work on a physical medium, you must return the medium with
your written explanation. The person or entity that provided you with
the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a
refund. If you received the work electronically, the person or entity
providing it to you may choose to give you a second opportunity to
receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy
is also defective, you may demand a refund in writing without further
opportunities to fix the problem.
1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth
in paragraph 1.F.3, this work is provided to you 'AS-IS' WITH NO OTHER
WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO
WARRANTIES OF MERCHANTIBILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.
1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied
warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages.
If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the
law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be
interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by
the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any
provision of this agreement shall not void the remaining provisions.
1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the
trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone
providing copies of Project Gutenberg-tm electronic works in accordance
with this agreement, and any volunteers associated with the production,
promotion and distribution of Project Gutenberg-tm electronic works,
harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees,
that arise directly or indirectly from any of the following which you do
or cause to occur: (a) distribution of this or any Project Gutenberg-tm
work, (b) alteration, modification, or additions or deletions to any
Project Gutenberg-tm work, and (c) any Defect you cause.
Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg-tm
Project Gutenberg-tm is synonymous with the free distribution of
electronic works in formats readable by the widest variety of computers
including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists
because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from
people in all walks of life.
Volunteers and financial support to provide volunteers with the
assistance they need, are critical to reaching Project Gutenberg-tm's
goals and ensuring that the Project Gutenberg-tm collection will
remain freely available for generations to come. In 2001, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure
and permanent future for Project Gutenberg-tm and future generations.
To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation
and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4
and the Foundation web page at http://www.pglaf.org.
Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive
Foundation
The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non profit
501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the
state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal
Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification
number is 64-6221541. Its 501(c)(3) letter is posted at
http://pglaf.org/fundraising. Contributions to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent
permitted by U.S. federal laws and your state's laws.
The Foundation's principal office is located at 4557 Melan Dr. S.
Fairbanks, AK, 99712., but its volunteers and employees are scattered
throughout numerous locations. Its business office is located at
809 North 1500 West, Salt Lake City, UT 84116, (801) 596-1887, email
business@pglaf.org. Email contact links and up to date contact
information can be found at the Foundation's web site and official
page at http://pglaf.org
For additional contact information:
Dr. Gregory B. Newby
Chief Executive and Director
gbnewby@pglaf.org
Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation
Project Gutenberg-tm depends upon and cannot survive without wide
spread public support and donations to carry out its mission of
increasing the number of public domain and licensed works that can be
freely distributed in machine readable form accessible by the widest
array of equipment including outdated equipment. Many small donations
($1 to $5,000) are particularly important to maintaining tax exempt
status with the IRS.
The Foundation is committed to complying with the laws regulating
charities and charitable donations in all 50 states of the United
States. Compliance requirements are not uniform and it takes a
considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up
with these requirements. We do not solicit donations in locations
where we have not received written confirmation of compliance. To
SEND DONATIONS or determine the status of compliance for any
particular state visit http://pglaf.org
While we cannot and do not solicit contributions from states where we
have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition
against accepting unsolicited donations from donors in such states who
approach us with offers to donate.
International donations are gratefully accepted, but we cannot make
any statements concerning tax treatment of donations received from
outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.
Please check the Project Gutenberg Web pages for current donation
methods and addresses. Donations are accepted in a number of other
ways including checks, online payments and credit card donations.
To donate, please visit: http://pglaf.org/donate
Section 5. General Information About Project Gutenberg-tm electronic
works.
Professor Michael S. Hart is the originator of the Project Gutenberg-tm
concept of a library of electronic works that could be freely shared
with anyone. For thirty years, he produced and distributed Project
Gutenberg-tm eBooks with only a loose network of volunteer support.
Project Gutenberg-tm eBooks are often created from several printed
editions, all of which are confirmed as Public Domain in the U.S.
unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily
keep eBooks in compliance with any particular paper edition.
Most people start at our Web site which has the main PG search facility:
http://www.gutenberg.org
This Web site includes information about Project Gutenberg-tm,
including how to make donations to the Project Gutenberg Literary
Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to
subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.